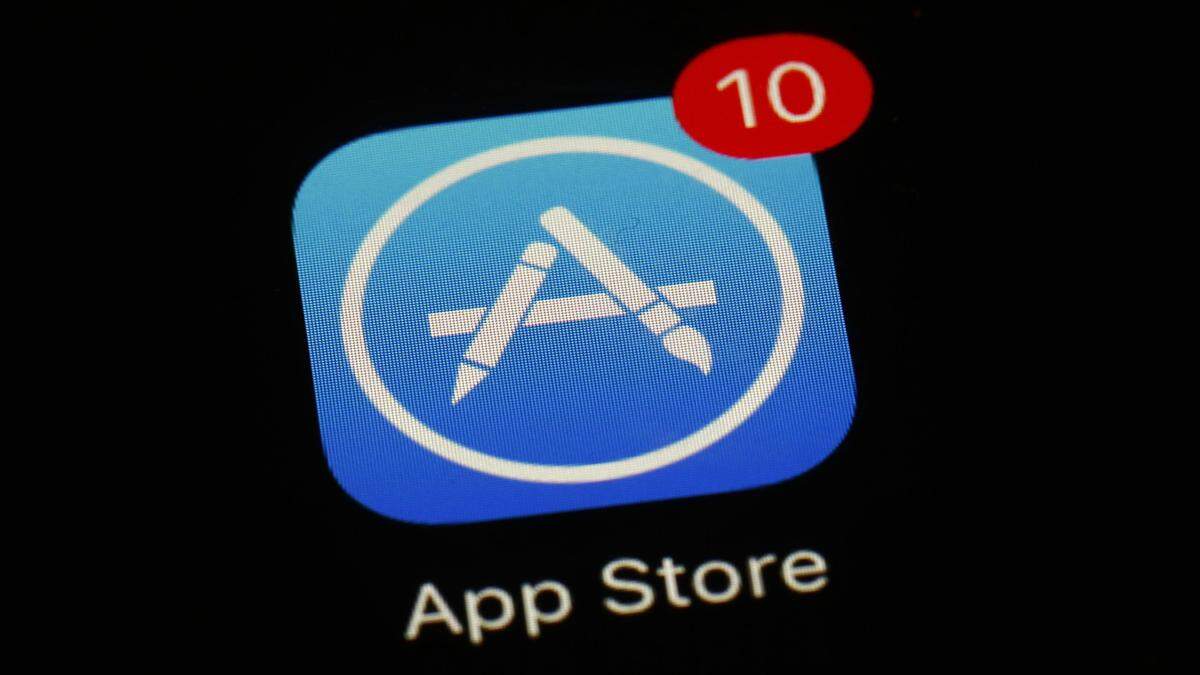Es soll ein Abtausch gewesen sein, der Apple schlussendlich in Bewegung brachte. Weil EU-Kommissarin Margrethe Vestager Apple-Boss Tim Cook im persönlichen Treffen versprochen haben soll, Apples Nachrichtendienst iMessage regulatorisch vorerst nicht anzugreifen, habe Apple wiederum zugesichert, die Öffnung seines App-Marktplatzes zu beschleunigen. So vermutet es jedenfalls das für gewöhnlich gut informierte Portal „The Verge“.
Jedenfalls wurde letzte Woche überraschend früh spruchreif, dass Apple mit dem Erscheinen des neuen Betriebssystems iOS 17.4. im März eine markante Lockerung vollziehen wird. Zumindest innerhalb der Europäischen Union. Passenderweise zu den parallel dazu in Kraft tretenden Regeln des europäischen Digital Markets Act (DMA), der explizit das Ziel verfolgt, die Marktmacht großer Plattformen zu begrenzen.
Wie Apples Öffnung aussieht? Erstmals lässt der iPhone-Hersteller alternative Marktplätze zu, Nutzerinnen und Nutzer müssen ihre Apps fortan also nicht mehr zwingend von Apples App Store herunterladen. Epic Games könnte den Spieleklassiker Fortnite so wieder aufs iPhone bringen, Meta und Microsoft ihre vorbereiteten Marktplätze aufsperren. Darüber hinaus gibt der IT-Krösus aus Cupertino erstmals grünes Licht für Browser, die nicht auf der hauseigenen Webkit-Technologie basieren. Eine Chance für Googles Chrome-Browser oder Firefox.
Alternativen brauchen Genehmigung
Zugleich – und an dieser Stelle wandelt sich die anfängliche Überraschung in Erwartung – macht Apple das alles weder frohen Mutes noch besonders offenherzig. Im Gegenteil zieht der Konzern parallel zur Öffnung einige neue Schranken ein. Stets argumentiert mit Sicherheitsrisiken, die durch die neue Infrastruktur entstehen würden.
So müssen die neuen Marktplätze, die Apple wohl recht bewusst nicht „Stores“ nennt, erst einmal Genehmigungsverfahren durchlaufen. Darüber hinaus haben auch sämtliche Apps mit einem gültigen Apple-Zertifikat ausgestattet zu sein. Die Sandbox-Architektur, Apps können keine von anderen Apps gespeicherten Informationen abrufen oder verändern, gilt freilich ohnehin für sämtliche Anwendungen, die über die alternativen Marktplätze vertrieben werden.
50-Cent-Zahlung sorgt für Ärger
In einem Aufwasch hat Apple auch gleich eine neue Vergebührungsarchitektur präsentiert – die sich zunächst verlockend liest. Werden die Apps über einen alternativen Marktplatz verkauft, fallen nämlich keine Abgaben an Apple an. Erst wenn die App weiterhin im App Store auftauchen will, müssen 10 bis 17 Prozent abgeliefert werden. Der Haken greift, wenn die Anwendungen populärer werden. Wird eine Drittanbieter-App öfters als eine Million mal pro Jahr installiert, fällt für jede weitere Installation eine Gebühr von 50 Cent an.
Besonders delikat: Dem Vernehmen nach sollen auch sämtliche App-Updates als Installation zählen. Ein recht offener Angriff auf die großen und rasch wachsenden App-Anbieter, für die ein Jahr ohne Aktualisierung undenkbar ist. „Core Technology Fee“ nennt Apple die neue Abgabe, eine schnelle Hochrechnung lässt deren Dimensionen erahnen. Meta etwa müsse in Europa alleine für Facebook jährlich 67,5 Millionen Euro an Apple zahlen. Ein Teil davon für Menschen, die die Facebook-App seit Jahren nicht mehr öffneten, aber automatisch aktualisieren lassen. Eine „Giftpille“ nennt Basecamps David Heinemeier Hansson die neue Fee deswegen.
Reaktionen reichen von „Horror“ bis „Farce“
Übrigens, so zumindest der Plan, müssen auch alle alternativen Marktplätze die 50-Cent-Abgabe zahlen. Eine Millionen-Grenze gibt es für sie nicht. Die unmissverständliche Botschaft an die App-Studios: Bleibt in Apples App Store, zahlt weiter eure standardmäßigen Abgaben und erspart euch einen möglicherweise kostspieligen und kaum kalkulierbaren Ausflug ins alternative Universum.
Allesamt Ingredienzien, die dafür sorgen, dass die Reaktionen auf Apples Pläne bei Technologie-Unternehmen grosso modo kritisch bis entrüstet ausfallen. Epic-Chef Tim Sweeney spricht von einer „Horror-Show“, Spotify von einer „Farce“ und Firefox-Entwickler Mozilla kommt nach erster Einsicht zur Erkenntnis, dass die neuen Voraussetzungen „ein weiteres Beispiel dafür sind, dass Apple Barrieren errichtet, um echten Browser-Wettbewerb unter iOS zu verhindern“.
Am Ball sind nun wieder die EU-Regulatoren. Diese prüfen Apples Vorschläge und wollen bald ein Urteil fällen, ob sie im Einklang mit den Regeln des DMA stehen. Tun sie das nicht, wird die Europäische Kommission ein Nachschärfen einfordern.