Mit Falco fing es an. Ich muss etwa schulreif gewesen sein, als ich durch ihn das erste Mal eine Ahnung von dieser seltsam anderen Möglichkeit des Deutschseins erfuhr. Inkorrektheiten seien mir an dieser Stelle verziehen, ich war erst sechs oder sieben Jahre alt und versuche jetzt, meine Annäherung an Österreich nachzuzeichnen. Und wie für viele andere Menschen, die in Deutschland leben, bleibt das Österreichische eben lange eine reizvolle Spielart des Deutschen.
Falco irritierte und faszinierte mich mit seiner Exaltiertheit in „Rock me Amadeus“. Ich lernte, dass Arroganz und über die Stränge schlagen, „zu viel des Guten“ nicht gleich bestraft werden musste. Das „zu viel“ galt ebenso für Schmerz und Verzweiflung: Als Falco „Jeanny“ veröffentlichte, erfuhr ich, dass man diese auf Deutsch auch herausschreien konnte. Dass man ihn nicht um jeden Preis sozial verträglich herunterdimmen musste. Und obwohl ich den Text inhaltlich nicht verstand, spürte ich das Verbotene an diesem Lied. Mit dem ansonsten so seichten Gedudel in der ZDF-Hitparade hatte das nichts zu tun.
An der Grenze
Als ich dreizehn war, fuhr ich in den Sommerferien an den Wolfgangsee. Ich besaß noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit und meine Eltern hatten es versäumt, mir ein Visum für Österreich zu besorgen. „Es wird sich schon irgendwie ausgehen“, werden sie damals sinngemäß, sehr undeutsch, aber sehr iranisch, gedacht haben. Mein Ausweis war nichts als ein Fetzen Papier. Ich hielt ihn in meinen feuchten Händen und bangte, als wir uns im Schritttempo der Grenze näherten. Dann öffnete sich die vordere Tür, zwei Uniformierte stiegen mit „Grüß Gott“ ein, blieben aber beim Fahrer stehen. Ich hörte sie lachen, dann stiegen sie wieder aus und der Busfahrer beschleunigte. Ich lernte, dass Grenzen nicht für alle Menschen eine ernste Sache waren.
Den Wolfgangsee liebte ich gleich. Ich liebte den Anblick des Schafbergs. Wir gehen da jetzt rauf, sagten die Betreuer. Den ganzen Weg über verfluchte ich sie, am Gipfel angelangt, bedankte ich mich euphorisiert bei ihnen. Ich lernte, dass man belohnt wurde, wenn man sich vorher nur ausreichend gequält hatte. Außerdem, dass man als Hauptspeise etwas Süßes essen konnte.
Bundesländer kannte ich nicht
Wenige Jahre später, ich war 17 oder 18 Jahre alt und besaß immer noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, fuhr ich allein mit dem Zug nach Linz. Immerhin konnte man das Visum für Österreich zu dieser Zeit schon direkt an der Grenze erwerben. Nach Linz fuhr ich, um einen jungen Mann zu besuchen, den ich in Prag kennengelernt hatte und der in der Nähe des Attersees wohnte. In Prag hatte er sich mir als Oberösterreicher vorgestellt, was mich verwirrte. Bundesländer spielten in meinem Leben keine Rolle. Wir fuhren viel in der Gegend herum, der Attersee lag in meiner Erinnerung immer im Nebel. Er erzählte mir von Hermann Nitsch, ansonsten redete er aber kaum. Ich lernte, dass Oberösterreicher eher schweigsam waren und dass man auch mit Blut und Kot Kunst machen konnte.
Danach fror mein Bild von Österreich ein paar Jahre ein. Zwar las ich Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann und Peter Handke, aber ich las sie nicht in dem Bewusstsein, österreichische Stimmen zu hören. Sie mischten sich einfach unter die Bölls, Koeppens und Grass’. Mein größter Frevel, vermute ich.
Bis ich meinen Mann kennenlernte, einen Grazer. Ich lernte, dass Steirer eher gesprächig waren. Als er mich fragte, ob ich mit ihm nach Österreich gehen würde, zögerte ich keine Minute. 2012 zogen wir um.
Seitdem lerne ich andauernd. Dass es vielen Menschen sehr gut geht, lernte ich etwa, als ich beim Landeanflug auf Graz die Swimmingpools zählte. Bei meiner ersten Brettljause lernte ich, dass man auf eine Scheibe Brot mehr als eine Scheibe Käse oder Aufschnitt legen kann.
Mein Deutschsein streifte ich ab
Ich lernte, dass Falco in „Der Kommissar“ nicht „Dadideldum“ singt, sondern „Drah di net um“ und dass ein guter Schmäh mehr wert ist als recht haben. Mein Deutschsein, irgendwie Teil von mir, aber irgendwie auch nur geliehen, streife ich zunehmend ab. Und je länger ich hier lebe, desto mehr wandelt sich meine ursprünglich reine, kindliche Faszination für dieses Land in das typisch widersprüchliche Verhältnis, an dem sich so viele abarbeiten.
Ziemlich österreichisch zum Beispiel lache ich mich am Morgen fast tot über die Karikaturen von Manfred Deix und sehe am Abend eine seiner Vorlagen als Amtsträger in den Nachrichten und kriege die Krise. Ich amüsiere mich über Ibiza und wende peinlich berührt den Blick ab, wenn es um die politische Aufarbeitung dieses Skandals geht. Ich freue mich täglich, wie tatkräftig sich viele Menschen für ein besseres Miteinander und gegen Rassismus engagieren, Kunst und Kultur gegen alle Widerstände hochhalten. Und ich schäme mich dafür, dass Österreich eines der EU-Länder ist, das keinen einzigen Geflüchteten aus Moria aufnimmt und Menschen aus ihrem Leben reißt, um sie nach Afghanistan abzuschieben.
Eine Million Ausgeschlossene
Ich schätze die Vielfalt in Österreich, das so viele kulturelle und sprachliche Einflüsse in sich verwoben hat. Ich versinke im Boden, wenn Politiker ihre Ansprachen mit „Liebe Österreicherinnen und Österreicher“ eröffnen und so bewusst weit mehr als eine Million Menschen ausschließen, die Teil dieser Gesellschaft sind, die österreichische Staatsbürgerschaft aber nicht besitzen. Diese zu erlangen ist so teuer und mühsam wie in kaum einem anderen EU-Land.
So wird es immer mehr Menschen geben, für die der 26. Oktober ein Tag ist, an dem man im besten Fall freihat, mehr nicht. Der Rest feiert Österreich. Dass sich selbst Sebastian Kurz, der im Jahr 2017 mit 31 Jahren als jüngstes Staatsoberhaupt Europas die Regierungsverantwortung übernahm, in seinen Ansprachen so gestrig zeigt – auch das wieder eine sehr hiesige Paradoxie.
Eine „schöne“ Paradoxie, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist es wohl, wofür ich Österreich bewundere: Es schreibt Geschichten, die ich mir nicht ausdenken kann.
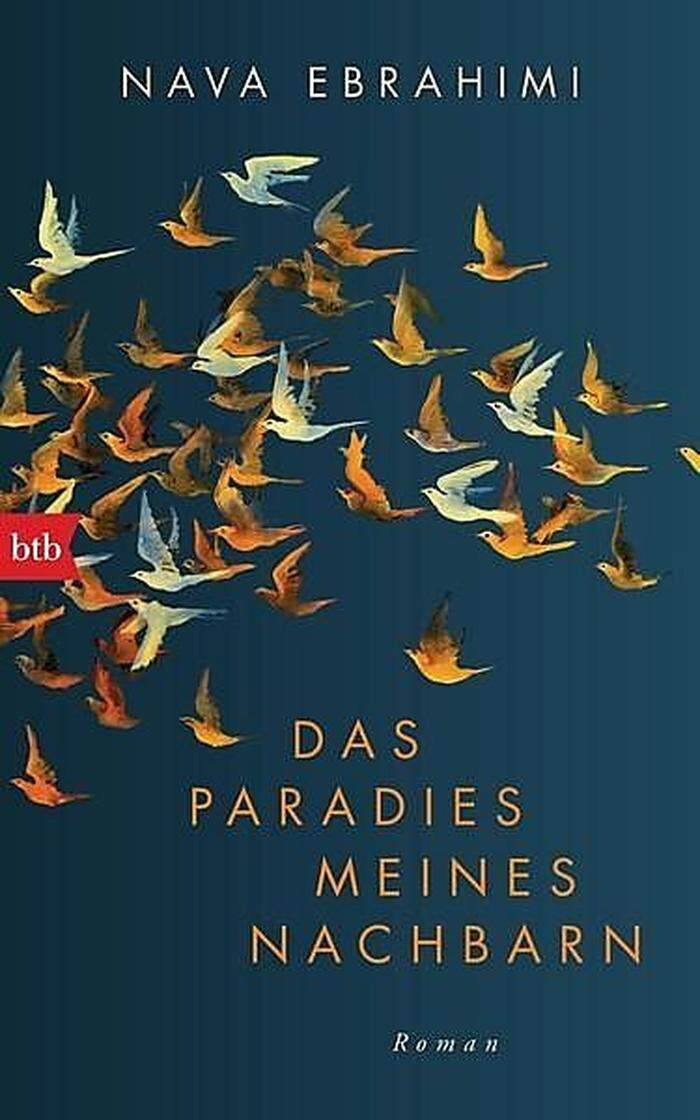
Buchtipp: Nava Ebrahimi. Das Paradies meines Nachbarn. btb. 224 Seiten, 20,90 Euro.
Nava Ebrahimi

