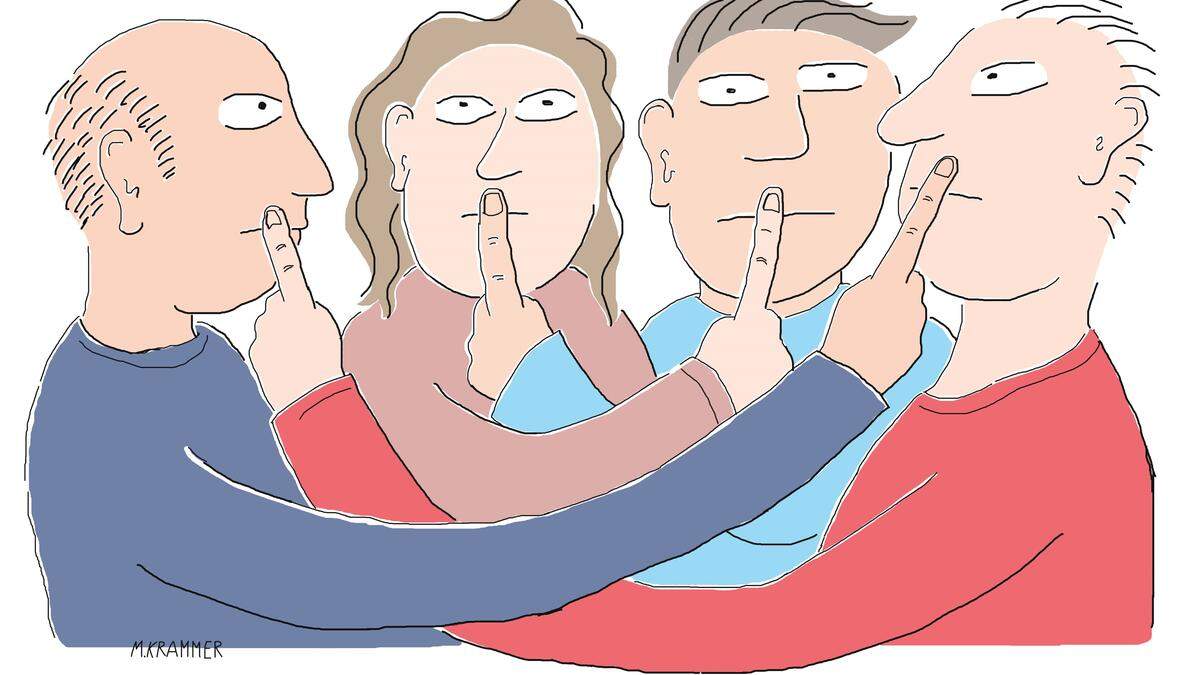Über Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, über Cancel Culture und die Einengung des Diskurses wird inzwischen vernehmlicher gestritten. Weiße, vor allem weiße Männer, sollen endlich ihre "Schuldigkeit" für Kolonialismus, Kapitalismus und patriarchale Herrschaft anerkennen, eingestehen und endlich Platz machen für andere. Auf öffentlichen Podien und in Talkshows, in universitären Diskussionen und Auswahlverfahren ist weniger die Argumentation und inhaltliche Positionierung relevant, als das Geschlecht, die Hautfarbe oder die Religionszugehörigkeit. Wer sprechen darf, was ausgesprochen werden darf und was nicht, unterliegt inzwischen neuen sozialen Regeln, die niemals offiziell ausgerufen oder demokratisch legitimiert wurden.
Dieses neue Regime der Woke Culture erzeugt einen Konformitätsdruck, der in den letzten Jahren immens gestiegen ist. Das kann man innerhalb der Volksparteien, im öffentlichen Dienst und Unternehmen ebenso beobachten wie besonders ausgeprägt im Kultur- und Wissenschaftsbetrieb. Die Bezeichnung "umstritten" hat längst ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, nämlich ein Streit um einen Inhalt, der von verschiedenen Positionen aus argumentativ geführt wird. Erst recht die so bezeichnete Person hat schon vor dem Streit verloren und soll geächtet werden. Besonders rigide können wir das vonseiten der linken Identitätspolitik beobachten.
Gesagt wird nur noch, was opportun ist
Immer häufiger gelingt es kleinen minoritären Gruppen, ihre Ziele gegenüber einer schweigenden Mehrheit durchzusetzen. Diese soziale Dynamik hat die Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann in den 1980er-Jahren beobachtet, nämlich die weitverbreitete Neigung, öffentlich nur das zu sagen, was opportun und dem Zeitgeist entsprechend erscheint, besonders bei moralisch hochbesetzten Themen. Wenn selbstbewusst vorgetragene Meinungsäußerungen, selbst einer kleinen Minderheit, auf Schweigen treffen, kommt die Schweigespirale in Gang.
Jüngstes Beispiel war die Ausladung der Biologin Marie-Luise Vollbrecht von der Langen Nacht der Wissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin vonseiten der Universitätsleitung. Sie gab dem Druck einer kleinen studentischen Gruppe nach, die das Auftrittsverbot gefordert hatte, weil die Referentin queerfeindlich sei. Die Wissenschaftlerin hatte in der Debatte um Transsexualität auf die biologische Existenz von zwei Geschlechtern gepocht.
Es geht nicht nur um spektakuläre Fälle von Ausladungen. Wie seit vielen Jahren in den USA halten auch bei uns wissenschaftsfremde moralisch-politische Prinzipien Einzug in den akademischen Betrieb, die auf die Transformation der Gesellschaft gerichtet sind: Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion. Sollten anfangs Gleichstellungstellen für Geschlechtergerechtigkeit sorgen, so verfolgen sie mittlerweile eine politische Agenda. Sie operieren mit Bezeichnungen wie "struktureller Rassismus" unserer "patriarchal-kapitalistischen" Gesellschaft, "Heteronormativität" und "Mehrheitsgesellschaft". All diese Begriffe verstehen sich als Kritik an Machtstrukturen, die transformiert werden sollen. Umschließt der Begriff "Gesellschaft" noch alle Bürger und Bürgerinnen, so impliziert "Mehrheitsgesellschaft" die Aufteilung in Diskriminierte diverser Opfergruppen einerseits und Privilegierte anderseits, die alle der Täterseite zugerechnet werden.
Dabei begann es durchaus emanzipatorisch. Völlig zu Recht schlossen sich seit den 1970er-Jahren Frauen und soziale Minderheiten zusammen, um für ihre Rechte einzutreten. Sie machten auf Diskriminierungen aufmerksam und begehrten gegen Sexismus und Rassismus auf. Doch Zug um Zug breitete sich mit dem Lob der kulturellen Vielfalt ein ideologisch gewordener Multikulturalismus aus, der die freiheitlichen Errungenschaften der westlich-europäischen Zivilisation relativierte. Immer neue soziale Gruppen, die sich als Opfer von gesellschaftlicher Benachteiligung verstanden, entwickelten ihre Opfernarrative und forderten besondere Rechte für sich. Eine regelrechte Opferkonkurrenz entstand: Wer wird am schlechtesten von der "Mehrheitsgesellschaft" behandelt und darf am meisten verlangen? Ihr Bezugspunkt ist eine kollektive Identität, die abgeleitet wird aus realer oder vermeintlicher Benachteiligung, Unterdrückung, Verfolgung, die teils Jahrhunderte zurückliegen: Frauen, sexuelle Minderheiten, die LGBTQI-Community, Migranten, ethnische und religiöse Minderheiten. Es geht um Wiedergutmachung erfahrenen Leids. Nicht für Individuen werden Rechte eingefordert, sondern für die jeweiligen Opferkollektive, die einen lautstarken moralisierenden Feldzug gegen die "Mehrheitsgesellschaft" führen. Sie treiben damit Polarisierungen voran, die den Zusammenhalt der Gesellschaft, der seit Jahren bröckelt, weiter schwächen.
"Kulturelle Avantgarde" ist schick
Obwohl diese Ideen von einer kleinen akademischen Minderheit ausgegangen sind, haben sie sich erstaunlich weit verbreitet. Wer möchte sich schon gegen Forderungen nach sozialer und kultureller Gerechtigkeit aussprechen? Erst recht nicht, wenn diese Identitätspolitik keinen wirklich hohen Preis hat, sondern vor allem Symbolpolitik ist?
Es ist schick, sich als kulturelle Avantgarde zu begreifen. In Teilen der gut ausgebildeten, kosmopolitisch orientierten, urbanen Mittelschicht findet die neue Sprache großen Anklang. Die identitätspolitischen Werte zählen ebenso zum Habitus wie veganes Essen. Neben der Gewissheit, moralisch gut zu handeln, verspricht dies Distinktion gegenüber der vermeintlich zurückgebliebenen "Mehrheitsgesellschaft". Im Kultur- und Medienbetrieb und im öffentlichen Dienst sind diese Ideen angekommen, und auch in der Wirtschaft. Große Firmen integrieren sie in ihre Unternehmenskommunikation und Marketingkonzepte, um zu zeigen, dass sie gute Zwecke verfolgen. Digital-Giganten im Silicon Valley verstehen sich besonders als politisch-moralische Botschafter. Die Regenbogenfarben haben inzwischen allseits in der Werbeindustrie Eingang gefunden.
Doch je mehr tatsächliche Fortschritte wir im realen Leben im Feld der Gleichstellung haben, umso unerbittlicher treten die Aktivist***Innen der Gender und Postcolonial Studies und ihre NGOs auf. Und die Mehrheit der Bevölkerung reagiert mit Unverständnis.
Die Sorgen um die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Wissenschaft sind nicht aus der Luft gegriffen. Wenn sich Denk- und Redeverbote breitmachen, ein Klima der Einschüchterung und des Konformismus entsteht, hat dies weitreichende Folgen. Die Studienabgänger sind die künftigen Leistungsträger und verbreiten diese Ideen und diese Sprache. Mut zum Widerspruch und die Fähigkeit, dem Konformitätsdruck in Gestalt der Schweigespirale zu widerstehen, will gelernt sein, vor allem die Fähigkeit, Konflikte und Ambivalenzen auszuhalten. Wir brauchen freie, offene Debatten ohne Tabus. Nur in der Pluralität der Meinungen, der Forschungsmethoden, die im zivilisierten Streit aufeinandertreffen, sind festgefügte Gesinnungslager aufzubrechen, kommt der Wettbewerb der Ideen wieder in Gang. Nur so wird es uns gelingen, Polarisierungen aufzulösen und ernsthaft den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu suchen. Unsere Freiheiten werden bedroht. Erst wenn wir sie wertschätzen, können wir sie hüten und schützen.
Ulrike Ackermann