Sehen wir doch, wie schwer es heute erwachsenen Männern wird, sich in den Gedanken hineinzudenken, dass die Frau wirklich gleichberechtigt, gleichbefähigt ist“, stellte die sozialdemokratische Abgeordnete Therese Schlesinger am 29. April 1920 in der Konstituierenden Nationalversammlung fest. Die österreichische Revolution und die Gründung der demokratischen Republik Österreich am 12. November 1918 bedeuteten eine tief greifende gesellschaftspolitische Zäsur, die nicht nur das politische System und seine Institutionen, sondern auch die Mentalitäten der Menschen in einer ganz speziellen Weise herausforderten. Im Gesetz über die Staats- und Regierungsform Deutschösterreichs wurde die Ausschluss-Kategorie Geschlecht abgeschafft und Frauen wurden wahlberechtigt – Prostituierte erst nach der Verabschiedung der Bundesverfassung 1920. Mit der Reform des Vereinsrechts am 30. Oktober 1918 und der Abschaffung des diskriminierenden § 30 konnten sich Frauen erstmals – monogeschlechtlich oder gemeinsam mit Männern – in politischen Vereinen und Parteien organisieren.
Die Einführung des Frauenwahlrechts war eine umstrittene Sache. Von den etablierten politischen Parteien hatte allein die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) seit 1891 das allgemeine, gleiche, aktive und passive Wahlrecht „ohne Unterschied des Geschlechts“ im Parteiprogramm verankert. Ihrer Funktion als Ordnungsmacht in der sozialrevolutionären Situation seit 1917/18 waren diese grundlegenden gesellschaftspolitischen Änderungen zu verdanken – in Korrespondenz mit den langjährigen Forderungen und Kampagnen der bürgerlich-liberalen und der sozialdemokratischen Frauenbewegungen, die nicht nur in der Habsburgermonarchie, sondern auch international vernetzt durchgeführt wurden. Im Kontext von Kriegsende, Zusammenbruch der Monarchie und Hungersnot wurde das Thema Frauengleichberechtigung nicht zentral in der Öffentlichkeit verhandelt, und die Haltung der Christlichsozialen Partei (CSP) und der deutschnationalen Großdeutschen blieb bis zum Herbst 1918 skeptisch bis ablehnend.
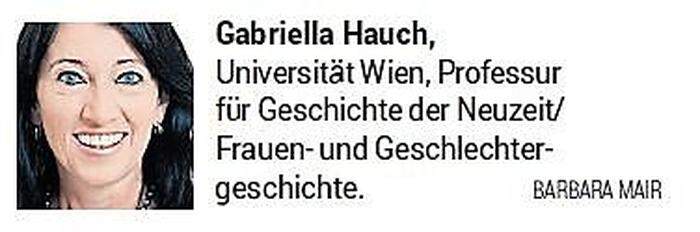
Erst die Einsicht, dass durch die große Masse der katholisch gesinnten und organisierten Frauen in ländlichen Gebieten Österreichs vor allem die CSP davon profitieren würde, leitete einen Stimmungsumschwung ein. Das heißt, die weitverbreitete Erzählung, das Wahlrecht sei die Belohnung der Frauen für ihren Einsatz an der „Heimatfront“, hält der wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand.
Vielmehr ist festzustellen, dass die Einführung des Frauenwahlrechts nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Österreich, Deutschland, der Tschechoslowakei, Polen etc. vor allem Länder traf, die zu den sogenannten Kriegsverlierern zählten, von sozial(revolutionär)en Unruhen betroffen waren und in denen eine politische Organisation zentral agierte, die das Frauenwahlrecht im Parteiprogramm verankert hatte. Nicht geändert wurden in der jungen Republik etliche andere Frauen diskriminierende Gesetze und Bestimmungen.

Die bürgerliche Moderne war zwar angetreten, eine gerechtere Welt zu schaffen, in der Konkretisierung machten Freiheit und Gleichheit jedoch weiterhin an den Geschlechtergrenzen halt. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 bestimmte den Mann zum Haupt der Familie; Mädchen wurden nun zwar auch an staatlichen Gymnasien aufgenommen und alle Fachrichtungen auf den Universitäten für Studentinnen geöffnet (bis auf Theologie), aber viele Berufsausbildungen waren ihnen nach wie vor verschlossen. Die 1918 eingesetzte „Kommission für Frauenarbeit“, gebildet aus Vertreterinnen verschiedenster Organisationen, von der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs bis zur Gewerkschaftskommission, sollte sich Gedanken über den Abbau der weiblichen Arbeitskräfte in der Industrie machen, um für die heimkehrenden Krieger (relativ gut bezahlte) Arbeitsplätze bereitstellen zu können. Besonders perfide lautete die in der Kommission, aber auch in der medialen Öffentlichkeit prolongierte Begründung, es ginge um den Schutz der „Weiblichkeit“ in Form des Arbeiterinnenschutzes, etwa um das Nachtarbeitsverbot für Frauen. Zweifellos sozialpolitisch anzustrebende Ziele, hier wurden sie ausschließlich unter dem Gesichtspunkt „Abbau der Frauenarbeit“ diskutiert.

Ein Familienmodell, wie es im ABGB festgeschrieben war, das einen männlichen Familienerhalter (male bread winner) vorsah und nur für eine sehr kleine Gesellschaftsschicht gültig war, wirkte auch in den Sozialgesetzgebungen der Konstituierenden Nationalversammlung 1919/20 als Resonanzboden. Zwar wurden Frauen nicht mehr explizit per Geschlecht benachteiligt, aber die Geschlechterverhältnisse wirkten nun strukturell weiter, man könnte sagen unsichtbar, falls nicht explizit danach gefragt/geforscht wird (das gilt bis ins 21. Jahrhundert, etwa für die Ursachen des gender gap in der Lohnfrage). Zum Beispiel wurde im Arbeitslosenversicherungsgesetz von 1919 allen die Unterstützung entzogen, die vor dem Ersten Weltkrieg nicht unter die Krankenversicherungsgesetzgebung gefallen waren, was vor allem die Erwerbstätigkeit von Frauen betraf oder bestimmte Berufe, die keine starken Gewerkschaften hinter sich hatten, wie Blumenmacherinnen, Hemdennäherinnen, Kaffeehausköchinnen etc.
Politikerinnen aller Parteien suchten diesen Missständen entgegenzuwirken. Bei den ersten Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919 stellten Frauen 52,16 Prozent der Wahlberechtigten, 82,10 Prozent betrug der wählende Frauenanteil, 86,97 Prozent der der Männer; acht Sozialdemokratinnen und eine christlichsoziale Abgeordnete wurden gewählt.

Zahlenmäßig am meisten Frauen im Nationalrat der Ersten Republik gab es in der Legislaturperiode von 1920 bis 1923, insgesamt zwölf, acht Sozialdemokratinnen, zwei Christlichsoziale und zwei deutschnationale Großdeutsche (GDVP). Das mag nach wenig klingen, ist aber eine Zahl, die erstmals in den 1970er-Jahren der Zweiten Republik übertroffen wurde: 1975 waren 14 Frauen Nationalratsabgeordnete. Bereits in den 1920er-Jahren lernten die weiblichen Abgeordneten schnell das Handwerk Partei/Politik, wie die Aktionen der CSP- und GDVP-Frauen vor den Nationalratswahlen 1930 zeigen, da seit 1927 keine von ihnen im Nationalrat vertreten war. Die CSP-Frauen kündigten dem Parteivorstand an, sich im Wahlkampf nicht zu engagieren, falls nicht eine Frau auf sicherer Stelle kandidieren würde, die GDVP-Frauen stellten ihre Unterstützung einer Kandidatur der „Österreichischen Frauenpartei“ in Aussicht. Trotz massiver Stimmenverluste zogen eine christlichsoziale und eine großdeutsche Abgeordnete in den Nationalrat ein.

Die Wahlbeteiligung bei Frauen stieg um ein Prozent auf 89 Prozent, die der Männer blieb mit 90 Prozent gleich. Zum ersten Mal hatten fast 1000 Frauen öfter sozialdemokratisch gewählt als christlichsozial. Die politische Kultur der Zeit prägte auch das Verhältnis der elf weiblichen Abgeordneten (von 165) – von „wir Frauen“ war keine Rede mehr.
Die eingangs zitierte Abgeordnete Therese Schlesinger, jüdischer Herkunft, war eine außergewöhnliche Politikerin und suchte, jenseits der Klassenfrage die politische Gleichberechtigung aller Frauen voranzutreiben. Obwohl die weiblichen Abgeordneten entsprechend ihren Parteizugehörigkeiten Welten trennten, gelang es Schlesinger, gemeinsam mit den christlichsozialen Hildegard Burjan und Olga Rudel-Zeynek und der deutschnationalen Großdeutschen Emmy Stradal Anfang der 1920er-Jahre eine frauenpolitische Koalition zu schmieden. Ihr Thema: Mädchen- und Frauenbildung, d. h. die Subventionierung von privaten Mädchenmittelschulen, die Akzeptanz von Mädchen in den früheren Bubengymnasien sowie die Anstellung von Lehrerinnen an diesen öffentlichen Gymnasien.
Olga Rudel-Zeynek aus der Steiermark trat sogar öffentlich gegen ihren Parteikollegen, den Finanzminister, und dessen Budgetkürzungen für Mädchengymnasien auf. Mit den Worten: „Der Finanzminister spart eben dort, wo er das Gefühl hat, die Sache wurzelt nicht im Volksbewusstsein“, kritisierte sie seine populistische Politik.
Diese ersten weiblichen Abgeordneten hatten alle persönlich ihre Diskriminierung als Frauen an der Geschlechtergrenze erlebt.

Dementsprechend bemühten sie auf der Redebühne des Parlaments ebenso wie in der Öffentlichkeit das Kollektivsubjekt Frau: „im Namen der Frauen“ oder „vom Frauenstandpunkt aus“. Mit dieser Rede blieben sie nicht alleine – auch männliche Abgeordnete adressierten ein kollektives „Interesse der Männer“, wenn es zum Beispiel um erweiterte Unterhaltszahlungen für ledige Kinder und öffentliche Kindererziehungseinrichtungen ging, wie es Rudel-Zeynek oder Anna Boschek, sozialdemokratische Gewerkschafterin, im Nationalrat forderten. Sie war eine jener Abgeordneten, denen ihr politisches Engagement einen enormen sozialen Aufstieg brachte.
Im hohen Alter erinnerte sie sich an ihren Eintritt ins Parlament: „Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie mir zumute war, wenn ich mich durch das verflixte Juristendeutsch veralteter Gesetze hab durchbeißen müssen, und wenn ich, die Fabriksarbeiterin mit ihren vier Klassen Volksschule, an einem Tisch mit gewiegten Kronjuristen gesessen bin …“
Weitere Frauenthemen in der Ersten Republik waren die sozialrechtlichen Absicherungen von Hausgehilfinnen, Heimarbeiterinnen und Hebammen.
Hingegen blieben die Bereiche Reform des patriarchalen Familienrechts, die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, weitergehende Forderungen zur rechtlichen Gleichstellung „Frauensachen“ der Sozialdemokratie. In den Stenographischen Protokollen des Nationalrats, die von allen großen Tageszeitungen publiziert wurden, sind nicht nur diese Traditionslinien in der Frauen- und Geschlechterpolitik nachzuvollziehen, sondern auch für den Bereich der Ökonomie und somit für das Männerterrain Wirtschaftspolitik, etwa die frauenpolitischen Folgen der Genfer Sanierung 1922. Nicht nur Olga Rudel-Zeynek bemühte ihren frauenspezifischen Blick, indem sie die Not der Frauen thematisierte und an die Nächstenliebe ihrer Parteikollegen appellierte; die Sozialdemokratinnen Emmy Freundlich und Gabriele Proft forderten eine radikale Änderung der Wirtschafts- und Steuerpolitik zugunsten der Nichtbesitzenden und Maßnahmen des Staates gegen die Betroffenheit der Frauen durch die Sanierungsbestimmungen. Am 22. Februar 1928 hielt Gabriele Proft die erste frauenspezifische Budgetrede. Sie monierte – ganz Gender- Budgeting-Prämissen vorwegnehmend –, dass der 52-prozentige Frauenanteil der Bevölkerung ebenso Steuern zahle wie die 48 Prozent Männer, jedoch nicht gleichbehandelt würde. Von der Lohnungleichheit im öffentlichen Sektor bis hin zur ungleichen Sozialversicherung spannte sie den Bogen.
Diese frauen- und geschlechterpolitischen Inhalte wurden erst seit den 1970er-Jahren wieder diskursrelevant – nach einem massiven Schub durch die Entstehung der Neuen Autonomen Frauenbewegung. So nachhaltig wirkte die Zerstörung der jungen österreichischen Republik, die Abschaffung der Gleichberechtigung durch den autoritären christlichen Ständestaat und den Nationalsozialismus. Allerdings bewegen die Überlegungen und Konzeptionen der gleichstellungspolitischen Pionierinnen aus den 1920er-Jahren bis heute – da Geschlecht nach wie vor als Strukturkategorie unsere Gesellschaft, Politik wie Mentalitäten durchzieht.
Gabriella Hauch













