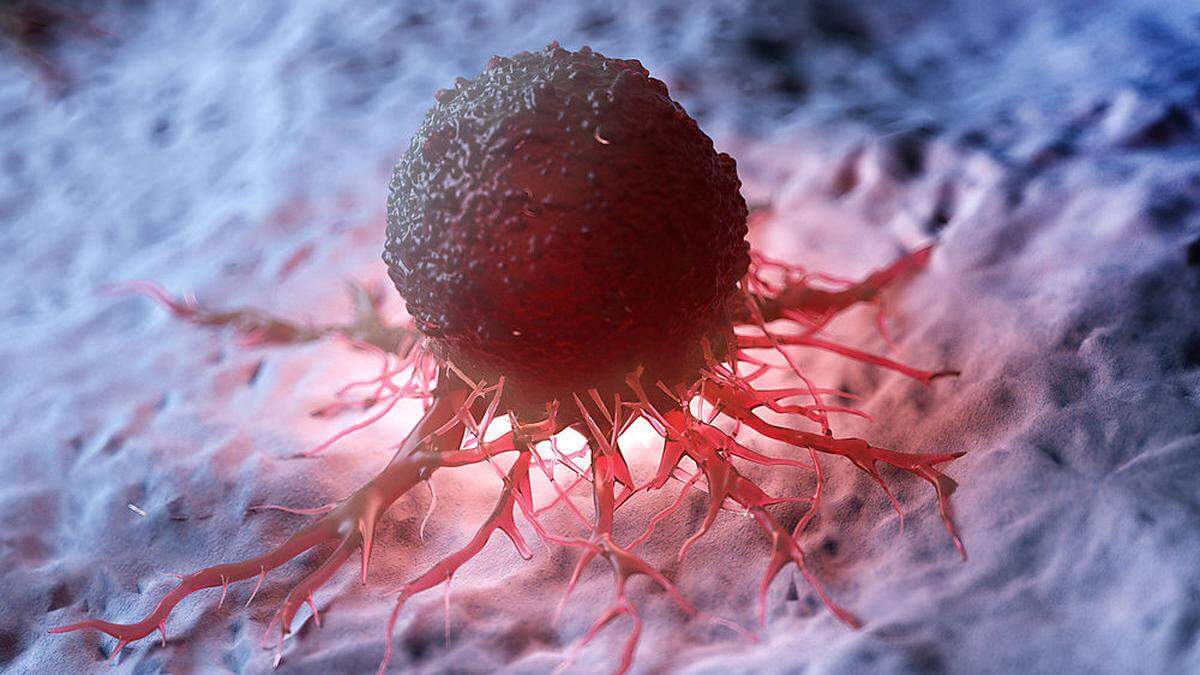Der bei der Corona-Impfung letztlich simple Schutz durch eine oder mehrere Spritzen könnte in Zukunft auch bei der Krebsbehandlung "den Weg für Patienten einfacher machen". Das sagte der Mediziner Wolfgang Hilbe im APA-Gespräch zur Entwicklung von mRNA-Vakzinen in der Onkologie. Die Forschung dahinter hat jedoch eine "komplexe Historie" von 30 Jahren, erläuterte der Vorstand der 1. Medizinischen Abteilung an der zum Wiener Gesundheitsverbund gehörenden Klinik Ottakring.
Schon lange im Blick
Die Anfänge der Wissenschaft rund um die mRNA-Impfstoffe für Krebspatienten gehen laut Hilbe auf den Beginn der 1990er-Jahre zurück. Es habe unter anderem Techniken gebraucht, um die Messenger-RNA so stabil zu machen, dass sie nicht gleich nach dem Kontakt mit Blut abgebaut wird, sagte der Mediziner zu dem langen Forschungszeitraum und bisherigen Phase-I- und -II-Studien, aber noch keiner Zulassung in der Onkologie. Die Entwicklung der mRNA-Vakzine gegen das Coronavirus sei jedoch einfacher und auf den geplanten Krebs-Impfstoffen begründet und daher so schnell gegangen.
"Das Immunsystem ist das, was uns die letzten Jahre sehr stark beschäftigt", erläuterte der Onkologe. Dabei gehe es darum, zu schauen, wie eine Krebszelle in die Interaktion mit den Immunzellen treten kann. Indem sich Zellen im Lauf des Alterungsprozesses des Menschen immer wieder teilen, entstehen auch laufend Fehler, beschrieb Hilbe Krebs vereinfacht dargestellt als "körpereigene Zelle, die falsch programmiert ist". Entweder werde dann die Krebszelle vom Körper als fremd erkannt und von den Immunzellen eliminiert, oder es könne passieren, "dass die Krebszelle im Lauf ihres Wachstums dem Immunsystem entkommt und das Immunsystem das nicht als Fehler erkennt".
Antikörper und T-Zellen
"Die große Hoffnung liegt darin, zu impfen", sagte der Universitäts-Professor. Bei den geplanten Krebs-Vakzinen erhält der Patient die RNA-Matrize für die Produktion der Antigene in seinem Körper, gegen die sich die gewünschte Immunantwort richten soll. Antigene sind jene Struktur, die vom Immunsystem als fremd erkannt wird. Diese werden dann meist durch die Bildung von Antikörpern sowie sogenannten T-Zellen ("Killerzellen") bekämpft. Es sei nun das Spannende zu schauen, wie man das dem Immunsystem mit einer Impfung präsentieren könne, erläuterte Hilbe.
Bösartige Tumore weisen auch von Mensch zu Mensch unterschiedliche "Neo-Antigene" auf, die auf gesunden Zellen des Patienten nicht vorkommen und somit für das Immunsystem bei entsprechender Unterstützung durch eine Impfung erkennbar sein müssten. "Es handelt sich um eine personalisierte, auf den Patienten zugeschnittene Impfung. Aus der jetzigen Perspektive würde man sagen, ich muss den Tumor haben und kennen." Dafür muss laut Hilbe der Tumor, der eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall hat, entfernt und das Oberflächenprofil analysiert werden. "Dann kann man relativ rasch einen Neoantigen-Cocktail mixen, mit dem man dann impft und dem Immunsystem erklärt, das wären jetzt deine Zielpunkte", sagte der Mediziner.
Erfolge scheinen unterschiedlich
Das macht die Therapie für den Patienten laut dem Onkologen einfacher: Der oder die Betroffene habe einen Tumor, wird operiert, geht nach Hause, erholt sich von der Operation, das Gewebe wird eingeschickt und analysiert und rund zwei Wochen später wird einmal geimpft und später eventuell noch einmal, erläuterte Hilbe. "Wir sehen, es funktioniert im Menschen", sagte er. In kleinen Studien seien Effekte gesehen worden, bei Melanomen beispielsweise mit guten Erfolgen, bei anderen soliden Tumoren war der Erfolg "nicht so ausgeprägt", die Studien dürften aber noch mehrere Jahre dauern.
Die Pandemie habe die Entwicklung von mRNA-Vakzinen gegen Krebs etwas gestoppt. Auf der anderen Seite ist laut Hilbe viel Know-how in der Produktion und in Sachen Transport und Lagerung gewonnen worden. Zudem hätten die betroffenen Firmen mit dem Corona-Impfstoff viel Geld verdient und könnten in neue Studien investieren. Die Kosten für ein zukünftiges Krebs-Vakzin sind noch unklar. Der Grundbedarf in der Entwicklung sei sehr teuer. Hilbe hofft aber, dass in der Coronakrise "in der Entwicklung so viel gelernt wurde, dass der Preis ein vernünftiger sein wird".