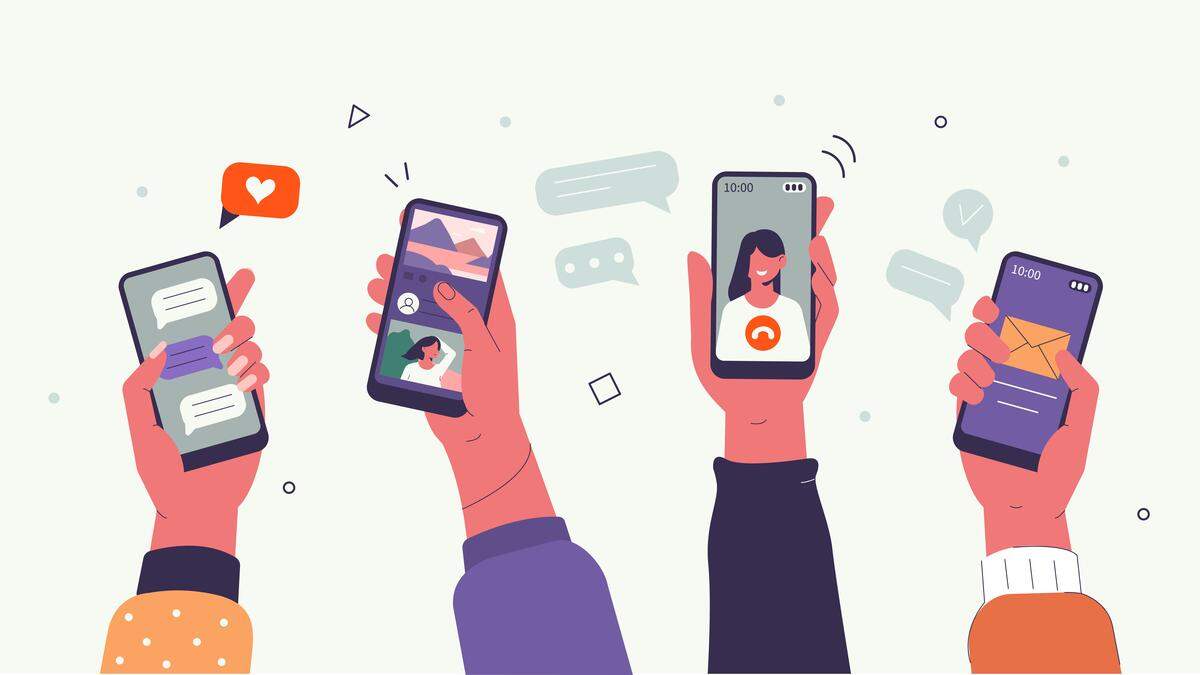Ein Interview mit dem Medienpädagogen Lukas Wagner in der letzten Woche sorgte für hitzige Diskussionen im Kleine-Zeitung-Forum: Darin erklärte Wagner, wie soziale Medien zur Verhaltenssucht führen können und forderte: „Handys müssen raus aus den Schulen“. Während viele Nutzer die Forderung von Wagner teilten (“Ganz klar: Das Handy hat in der Schule nichts verloren, nicht in der Klasse, nicht in der Pause“), kommentierten andere auch, dass es zu kurz gegriffen sei, das Handy zu verteufeln: „Anstatt das Smartphone zu verteufeln, sollte man eine produktivere Nutzung fördern“, schrieb ein Online-Nutzer.
Nicht nur in unserer Leserschaft, auch in der Wissenschaft wird die Frage der negativen Auswirkungen der Smartphone-Nutzung auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen intensiv diskutiert. Eine ganz aktuelle Studie aus den USA liefert dafür jetzt neuen Zündstoff: In der Befragung von 12- bis 17-Jährigen zeigte sich nämlich, dass Smartphones bei den Nutzern zu einer besseren Stimmung führen. Das ist aber nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht – auf den zweiten Blick kann dieser Effekt das Suchtpotenzial der sozialen Plattformen offenlegen. Denn: Die Studienergebnisse können auch so interpretiert werden, dass Jugendliche das Smartphone zur Stimmungsregulrierung einsetzen, was eine Komponente von Suchtverhalten ist.
Mittel zur Problem-Vermeidung
Wie sind diese Studienergebnisse nun zu bewerten? Adrian Meier, Juniorprofessor für Kommunikationswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sagt: „Dass Smartphone-Nutzung kurzzeitig die Stimmung aufhellen kann, ist durch viele Studien dokumentiert: Wenn mir langweilig ist, greife ich zum Smartphone, scrolle ein bisschen durch Social Media, schaue ein YouTube-Video und fühle mich gut unterhalten, abgelenkt von Sorgen.“ Kurzfristig könne das positive Folgen für die Stimmung haben. Allerdings könne eine auf Mediennutzung ausgerichtete Bewältigungsstrategie auch dysfunktional werden: „Dann nämlich, wenn ich lösbare Probleme nicht mehr angehe, sondern vorwiegend vermeide“, sagt Meier. Stimmungsregulierende Mediennutzung ist laut Meier somit nicht in jedem Fall problematisch – als dauerhafter Bewältigungsstil allerdings schon.
Das unterstreicht auch Medienpädagoge Lukas Wagner: „Durch das Handy kann ich mich ‚wegbeamen‘, wenn ich traurig oder gelangweilt bin. Wenn ich das manchmal mache, daneben aber noch andere Bewältigungsstrategien habe, wie Reden mit Freunden oder Rad fahren gehen, ist das kein Problem.“ Problematisch werde es dann, wenn das Smartphone das einzige verbliebene Mittel zur Gefühlsregulation ist, wenn die Alternativen fehlen. Wichtig sei auch, zu unterscheiden, was Jugendliche am Smartphone machen: Hier greife die aktuelle Studie zu kurz, wie Forscher bemängeln, da das nicht abgefragt wurde. Auch Medienpädagoge Wagner unterscheidet hier: „Als problematisch sehe ich die Social-Media-Plattformen: Sie vermitteln ungesunde Körperbilder, sie verkürzen die Aufmerksamkeitsspanne drastisch.“ Dienste wie WhatsApp, mit denen Nachrichten verschickt werden, hingegen seien viel weniger problematisch.
Was auf suchtartiges Verhalten hinweist
Bis dato ist die exzessive Nutzung von Social Media nicht als eigene Sucht klassifiziert – Forscher beschreiben aber Kriterien, die auf ein suchtartiges Verhalten hinweisen können:
- Kontrollverlust: Nutzer wollen die Zeit, die sie auf Social Media verbringen, reduzieren, es gelingt aber nicht
- Sehr starke Priorisierung: Was auf Social Media passiert, ist sehr wichtig, alles andere tritt in den Hintergrund
- Reale negative Konsequenzen: aufgrund des ständigen Gebrauchs geht eine Beziehung in die Brüche oder ein Ausbildungsplatz verloren
Was helfen könne, einem solchen problematischen Gebrauch von sozialen Medien vorzubeugen, sind: Klare Regeln, die von Eltern festgelegt und in einer möglichst positiven Stimmung vermittelt werden. Auch sind laut den Empfehlungen internationaler Forscher klare Handy-Regeln in Schulen eine wichtige Säule für den vernünftigen Umgang mit diesen neuen Medien. Und bei all der berechtigten Sorge dürfe man nicht vergessen, dass soziale Medien auch positive Seiten haben: Jugendliche könnten sich dort austauschen, gerade marginalisierte Gruppen können Gemeinschaften finden, in denen sie sich sicher fühlen können.
Mehr zu Social Media