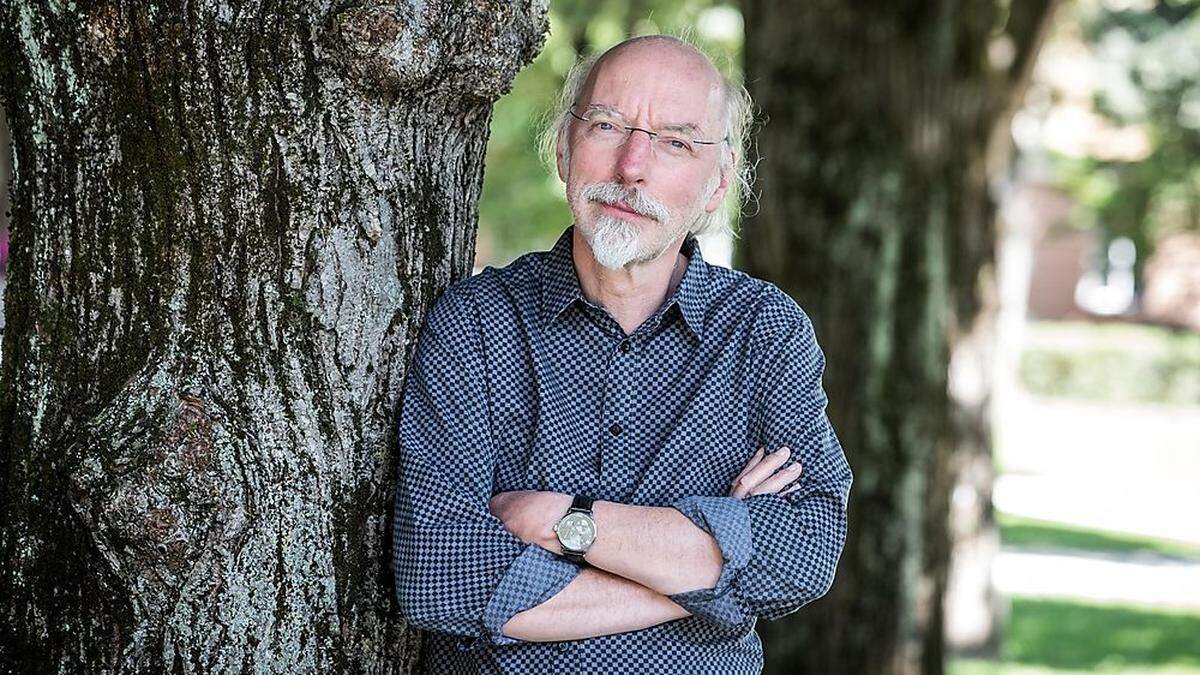Premiere beim Carinthischen Sommer: Erstmals wird eine Kirchen-Filmoper uraufgeführt, wenn heuer auch nur ein einziges Mal und konzertant. Die Basis liefert Carl Theodor Dreyers legendärer Stummfilm „Die Passion der Jungfrau von Orléans“ (1928), der anhand der originalen Akten vom Inquisitionsprozess gegen Jeanne d’Arc erzählt. Die Filmhandlung konzentriert sich auf die letzten Stunden im Leben des Bauernmädchens, das im Hundertjährigen Krieg Frankreich gegen England anführte. Die Musik dazu hat Johannes Kalitzke geschrieben. Es ist die vierte Oper des deutschen Komponisten und Dirigenten, coronabedingt weicht man aufgrund der großen Besetzung in die Villacher Stadthalle aus. Im kommenden Jahr soll die Kirchenoper dann auch szenisch aufgeführt werden. Die Librettistin Kristine Tornquist hat den Stummfilm um drei Szenen erweitert, welche die historische Erzählung mit den zeitlosen Fragen nach Identität und Rebellion reflektieren.
Herr Kalitzke, wie laufen die Proben auf Distanz?
Gut, aber es gibt gar nicht so große Unterschiede zur Normalsituation. Man orientiert sich sehr an der Praxis der Wiener Philharmoniker: testen und spielen. Bei den Bläsern wahrt man mehr Abstand als normal und bei den Sängern ist das sogar notwendig, weil sie etwas mehr an Aerosolen produzieren. Aber es hat keine nachteilige Auswirkung auf den Klang.
Aber hätten Sie jemals gedacht, dass einmal eine Ihrer Opern in einer Eishalle uraufgeführt wird?
Ich hätte mir bei der Größenordnung – es gibt ja über 100 Beteiligte – erst einmal gar nicht vorstellen können, dass man das Stück irgendwo realisieren kann. Ich finde das toll, wie man entgegen allen Widrigkeiten die Energie dafür aufbringt. Ob die Eishalle das akustisch beste Modell ist, kann ich nicht sagen. Komponiert ist die Oper für eine Kirche, und in einer Kirche hat man vier oder fünf Sekunden Nachhall. Da komponiert man ganz anders mit Klängen, die als Akzent gesetzt werden, sie klingen nach und dann mischt sich ganz leise etwas anderes hinein. In der Stadthalle kann die Tontechnikerin vielleicht mit bestimmten Maßnahmen etwas zaubern, aber ich freue mich schon, dass wir das Stück im nächsten Jahr dann in einer Kirche szenisch realisieren werden. Da kann man es so spielen, wie es gedacht ist.
Wie sehen Sie diese Jeanne d’Arc? Ist sie eine Heilige, eine Fanatikerin, eine Märtyrerin oder einfach eine Verrückte?
Das ist alles richtig. Starke Persönlichkeiten haben immer Seiten, die man verhaltensauffällig nennen kann. Sie werden auch in der Musik kein Genie kennen – egal ob Wagner oder Beethoven –, das nicht in irgendeiner Weise problematisch war.
Carl Theodor Dreyer zeigt in seinem Film sehr viele Großaufnahmen von Gesichtern, manchmal auch nur Augen oder einen Mund. Wie hat Sie das inspiriert?
Diese ganzen Profile und Gesichter haben einen Ausdruck, der etwas über ihre Stimmungslage und ihre Emotionen sagt – daran habe ich mich gehalten. Andererseits ist dieses spezielle Schnittverfahren von Dreyer, nur Profile zu zeigen und mit ganz schnellen Schnitten aneinanderzukleben, ein Stilmittel, das man in die Musik übernimmt. Es gibt etliche Passagen, wo diese scharfen Schnitte sich in der Musik widerspiegeln.
Komponisten sagen meistens, sie können ihre Musik nicht beschreiben. Aber könnten Sie es bitte für uns versuchen?
Man könnte sagen, es ist eine große Traumsequenz über mittelalterliche Musik. Das Ganze beruht auf einem Chanson, das im Mittelalter sehr populär war, und zwar „L’homme armé“. Komponisten wie Josquin Desprez oder Guillaume Dufay haben Messen geschrieben, in denen sie die Melodie übernommen haben. Ich habe bestimmte Sequenzen und Intervalltypen an einigen Stellen weiterentwickelt, sodass immer wieder dieser spezielle Früh-Renaissance-Sound durchkommt, wie ein atmosphärischer Fingerabdruck, der immer wieder durchleuchtet.
Sie setzen auch elektronische Elemente ein – wie schwierig ist es, alles zu verzahnen?
Das ist wirklich nicht leicht. Die Elektronik muss genau synchron zum Orchester, den Solisten und zum Chor laufen. Und als Dirigent hänge ich immer am Sekundenlaufwerk eines Bildmonitors. Der Film gibt sozusagen den Takt vor und wir müssen schauen, dass wir auch synchron zu den Bildern bleiben. Das ist ein Mörderstress. Da muss man als Komponist Ausgleichspunkte einplanen, damit man im Notfall ein paar Sekunden auch wieder einholen kann.
Ist es da ein Vorteil, wenn man nicht nur der Dirigent, sondern auch der Komponist ist?
Beim Komponieren stellt man sich vor: Geht eh alles. Aber wenn man dann dirigiert, stellt man fest, dass man sich wieder einmal selbst reingelegt hat, es ist alles anders. Da schimpft dann der Dirigent auf den Komponisten (lacht).
Vor zwei Jahren wurde Ihre Oper „Pym“ nach einem Roman von Edgar Allan Poe in Heidelberg uraufgeführt. Regisseur war der Kärntner Johann Kresnik (1939–2019). Welche Erinnerungen haben Sie daran?
Das war die beste Inszenierung, die ich je hatte. Er war ein Bauchmensch und hat alles über den Instinkt erfasst. Umgekehrt war es auch so: Es war ja halb Oper, halb Tanztheater und ich habe zu ihm gesagt: „Wie soll ich Musik zu den Tanzszenen schreiben, ich habe ja keinen Text?“ Da hat er dann Aquarelle gemalt und die Spielsituation so vorweggenommen. Und über eine Reihe seiner handgemalten Aquarelle die halbe Oper zu schreiben, war eine wunderbare Besonderheit.