In wenigen Tagen erhalten Sie in Stockholm den Literaturnobelpreis. Was wird die Auszeichnung mit Ihnen machen?
PETER HANDKE: Wie schaue ich aus? Was haben Sie denn für einen tiefen Eindruck von mir?
Am Telefon wirkten Sie gelöst.
Rüstig oder gelöst?
Gelöst.
Na ja, Goethe hat gesagt: Das Leben ist kurz, aber die Tage sind lang. Der Tag ist lang. Vor allem am Nachmittag kommt ein Moment, wo die Bewegung des Lebens nicht mehr sicher ist. Es nebelt. Es ist der Weg nicht mehr vorhanden. Am Abend geht es wieder. Das sind Momente, die man nicht in der üblichen Zeit rechnen kann. Das war bei mir immer so. Ich bin nicht der Einzige. Manche haben es beim Aufstehen. Bei mir kommt es halt am Nachmittag. Jetzt hat es seinen Grund.
Ist der Preis der Grund?
Nicht der Preis. Das Rundherum. Das Seltsame ist: Am Abend, wenn diese Momente vorbeigegangen sind, habe ich das Gefühl, dass ich diesen Preis täglich neu bekomme. Gerade durch das Rundherum. Vermeiden kann man es ja nicht. Ich will es auch nicht. Ich will mich ja auch stellen. Erst wenn das überstanden ist, kommt eine Art Freude auf.
Freude worüber?
Freude nicht für mich. Freude darüber, dass das, was ich geschrieben habe, jetzt ein Licht hat, das nicht so schnell vergehen wird. Habt ihr meine Sachen über Jugoslawien gelesen?
Wir haben auf dem Weg hierher „Die winterliche Reise“ noch einmal gelesen, für uns der zentrale Text in der Auseinandersetzung.
Ich meine alles!
Alles haben wir nicht gelesen.
Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich höflich bleibe. Es kommen Leute, die haben ein bisschen was angelesen von mir und trumpfen vor mir auf. Den Nächsten setze ich vor die Tür!
War Ihnen nicht bewusst, dass der Nobelpreis den alten Konflikt neu würde aufbrechen lassen wie eine schlecht vernarbte Wunde?
Nein, das war mir nicht bewusst.
Die Unerbittlichkeit und die Härte erinnern an einen Stammeskrieg.
Ah ja.
Ein Stammeskrieg zwischen denen, die Sie unbeirrt verehren, und jenen, die Sie verdammen. Wem misstrauen Sie mehr?
Kein Mensch verehrt mich. Die lieben, was ich geschrieben habe. Das ist Literatur, der Naturvorgang der Sprache, wenn sie vom Gefühl, vom Blick, vom Rhythmus ausgeht. Verehrung! Nihil admirari! Nichts bewundern! Wenn ich was lese, das mir durch und durch geht, ist es keine Bewunderung. Da verehre ich nicht den Autor. Das ist einer wie ich, der halt den Moment gefunden hat, die Zeit, den Ort, das Licht der Welt.
Werden Sie nach der Verleihung ein anderer sein? Sie sind dann für immer der Nobelpreisträger.
Die Rolle werde ich nie verkörpern können. Ich führe weiter mein Leben. Ich gehe ins Wirtshaus und gehe Brot kaufen.
So tun, als ob?
So tun, als ob, ist eine Kraft, sagt die Nova in „Über die Dörfer“.
Wird das Schreiben danach schwerer fallen?
Das lassen Sie meine Sorge sein.
Großen Sportlern ergeht es oft so, dass die Krönung sie lähmt.
O nein, ihr beiden! Nicht in meinem Alter. Ich bin froh, dass der Preis spät gekommen ist. Für Jüngere ist das nicht einfach. Ich habe noch einiges zu geben. Um mit Ibsen zu sprechen: Ich habe noch Pfeile im Köcher. Es wird auch die Ruhe wieder kommen.

Haben Sie sich gefragt, warum Sie in der Auseinandersetzung um Jugoslawien so allein dastehen?
Habe ich nicht, nein. Es gibt keine Antwort. Ich habe schon als Kind viel Hass auf mich gezogen, auch im Internat. Und dann anders wieder nicht. Vielleicht kommt das von meiner Abstrahlung, oder wie?
Vom Anderssein.
Ich bin aber nicht anders. Glaube ich. Man kann sich nicht selber definieren. Das ist ein großer Fehler. Aber die anderen kennen einen noch schlechter. Da ist es schon besser, man definiert sich selbst, als wenn andere ihr Maul aufreißen.
Aber es geht Ihnen nah.
Ja, es setzt mir zu.
Können Sie es beschreiben?
Vor Kurzem habe ich im „Parisien“ eine Meldung gelesen. „76-Jährige beim Oralsex mit achtjährigem Nachbarkind erwischt.“ Ich habe das mit meinen 76 Jahren gelesen, als ob ich das wäre. Kafkaesk. So durchdringend ist die Vergiftung. Jetzt gibt es so Momente von Empfindlichkeit, wo man sich auf fast humoristische Weise für alles Schändliche verantwortlich fühlt, was im Lokalteil passiert.
Wir nehmen nur wahr, dass Sie für die Teilnahme am Begräbnis von Milošević verantwortlich gemacht werden. Sagen Sie sich nie, ich hätte nicht hingehen sollen?
Warum sollte ich das?
Weil Milošević ein denkbar schlechter Kronzeuge für Ihre hehre Idee von Jugoslawien war.
Kommen Sie mir nicht mit dem Reden vom Sehnsuchtsland! Es gibt ein berühmtes Foto, das Milošević im Zentralkomitee zeigt, wo über den Zerfall von Jugoslawien abgestimmt wurde. Er hält darauf als einer der ganz wenigen ein Schild in die Höhe, mit dem er gegen die Vereinzelung und Staatserklärung der anderen stimmt.
Sie wollten Jugoslawien als pazifistische Idee bewahren, er mit den Mitteln militärischer Gewalt und repressiver Macht.
Das ist kein Tribunal hier. Ich bin da hingegangen, weil ich darum gebeten wurde. Anfangs wollte ich sogar kneifen. Ich bin dann in eine Kirche gegangen und habe eine Kerze angezündet. Zu dem Skandal wäre es nie gekommen, wenn der „Nouvel Observateur“ nicht diese Lügen verbreitet hätte, ich hätte Rosen auf den Sarg gelegt und den Sarg sogar geküsst. Bis zu dieser ganz winzigen Zeitungsnotiz, wo jeder Satz eine grausige Sauerei war, wäre nie etwas entstanden. Die sind zwar verurteilt worden, aber auf eine Entschuldigung warte ich bis heute. Wäre es nicht eure Aufgabe als Journalisten, diese Lügen aufzuzeigen? Nicht einmal Tolstoi hat so scheußliches Zeug erlebt wie ich. Statt dass Sie das Unrecht benennen, drücken Sie noch drauf. Sind Sie die Handelsvertreter des Hasses, oder was? Ich sage Sie in Abwesenheit, weil Sie gerade da sind.
Aber Sie mussten doch davon ausgehen, dass Ihre Anwesenheit am offenen Grab nicht anders denn als Sympathiebezeugung für einen Despoten gedeutet würde.
Für mich war dort das Jugoslawien zu Ende. Ein Freund hat mir einmal den Satz gesagt: In diesem Krieg sind alle Völker Jugoslawiens barfuß über Dornen gegangen. Es war ein Bruderkrieg. Kain wurde zu Abel und Abel zu Kain. Es geht nicht, dass jemand schreibt, ich hätte mich vor Milošević verbeugt, weder körperlich noch symbolisch. Nie habe ich irgendeine Sympathie für ihn ausgedrückt.
Sie haben Milošević im Gefängnis besucht.
Weil sein Anwalt mich darum gebeten hat. Das war das einzige Mal, dass ich Milošević gesehen habe, als Schwergefangenen im Gefängnis. Hinter 29 Stahltüren. Ich war halt da. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er mich benutzen wollte, aber er sah mich als Zeugen für später an, als Geschichtsschreiber. Er redete vom Amselfeld. Dass er den Serben dort gesagt habe: Niemand wird euch mehr schlagen. Mich hat das angeödet. Ich wollte ihn ablenken, aber er war nicht abzulenken. Dann kam das Begräbnis. Ramsey Clark, der ehemalige Justizminister der USA und Verteidiger von Saddam Hussein und Milošević, war auch dort. Aber das hat keinen Journalisten interessiert. Ich war der Scheinwerferheld.
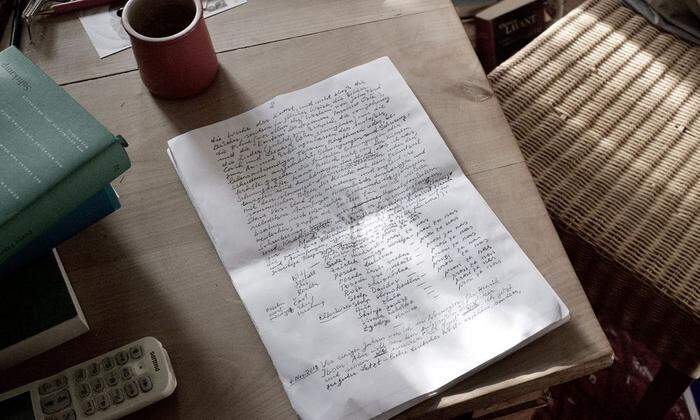
Verspüren Sie nicht das Verlangen, sich von allem zu befreien, indem Sie sich noch einmal ohne Zorn öffentlich erklären?
Sagen Sie mir, was ich sagen soll! Schreiben Sie mir eine Rede! Sie kriegen ein Zeilenhonorar. Was machen Sie sich für scheißverlogene Sorgen um mich? Ich bin ein freier Mensch. Ich kenne keinen freieren Menschen als mich. Ich sagen Ihnen: Ich habe keine Chancen gegen die, und diese Leute haben keine Chancen gegen mich. Das ist das Entscheidende. Im „Sturm“ von Shakespeare sagt einer: Die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier. Und die Teufel werden wieder in die Hölle gehen. So, jetzt kennen Sie meinen Gedankengang.
In den sozialen Netzwerken ziehen sich die Teufel nicht zurück.
Das ist wahr, aber ich kriege es nicht mit. Ich habe kein Internet. Sie können nicht über mich zu Gericht sitzen, denn sie haben keine Macht.
In Ihrer „Winterlichen Reise“ nach Serbien wollten Sie 1996 ein poetisches Gegenbild zur westlichen Kriegsberichterstattung entwerfen, hatten aber noch selber Zweifel und Bedenken, ob das nach den Gräueltaten zulässig sei.
Ich glaube, ich habe das in einer zarten, fragenden Weise gemacht, wie es halt meine Art ist. Ich bin ja kein Journalist.
Können Sie nachvollziehen, warum diese Gegenbilder, diese Poetisierung des Serbischen, für die Angehörigen der Opfer der serbischen Massaker unannehmbar waren und sind?
Nein, es war damals in den Zeitungen eine grausige Sprache im Gange. Die Einseitigkeit, das Vorgefasste im Urteil, war so bösartig. Dadurch ist meine Sprache so herausgefallen aus dem Ganzen. Die Fronten haben sich erst vier Wochen nach dem Erscheinen des Reiseberichts in der „Süddeutschen“ formiert. Das musste ja sein. Das ist Massenpsychenphysik. Das ist das Naturgesetz des Homo erectus, oder wie das heißt. Und dann war plötzlich ich ganz die Front, obwohl ich selber allein gar keine Front sein und bilden kann.
Aber ist man nicht Front, wenn man auf den Buchdeckel schreibt: „Gerechtigkeit für Serbien“. So kollektivistisch, dass alles mitgemeint sein kann: die Unschuldigen ebenso wie die Schuldigen?
Ja, Gerechtigkeit für Serbien! So war es, so ist es mir unterlaufen. Und jetzt soll ich ein Schuldbekenntnis abliefern, oder was?

Werden Sie?
Wenn Sie mir die ewige Seligkeit versprechen. Schon der amerikanische Verleger meiner „Winterlichen Reise“ hat mir damals in New York gesagt, dass ihm alles, was er zuvor zu Jugoslawien gelesen habe, wie Pornografie vorkomme. Ich bin kein Sprachspieler mehr. Aber es gibt das Wort Gesindel. Das Wort ist ein Hauptwort. Bei mir hat es sich in ein Zeitwort verwandelt. Jeden Tag, wenn ich wieder etwas höre, denke ich mir, es gesindelt wieder. Ich weiß ja nicht, wie das geht mit Twitter. Ich höre nur, wie das funktioniert. Für mich ist das eine Art von Endhorde.
Werden Sie in Ihrer Stockholmer Rede auf all das eingehen?
Nein. Ich werde darüber sprechen, was meine Mutter in meiner Kindheit von kleinen Begebenheiten erzählt hat, die mich zum Schreiber gemacht haben. Ich werde aus dem Anfang und dem Ende von „Über die Dörfer“ lesen und dann versuchen, auf Slowenisch aus der Lauretanischen Litanei zu zitieren, die ich als Kind in Stift Griffen oft gehört, aber nicht verstanden habe. Und dann gibt es noch eine Überraschung.
Vor der Akademie werden Ihre Gegner warten.
Die waren schon beim Ibsen-Preis in Oslo da. Ein ganzes Spalier. „Faschist, Faschist!“ haben die geschrien. Ich bin stehen geblieben und habe gesagt: Wie geht’s? Aber die haben einfach weiterskandiert. Und dann habe ich einen Fluch losgelassen, den ich auf Serbokroatisch sehr gern habe.
Der war vermutlich nicht schön.
Aber lustig. „Jebote miš“ Kennen Sie den? „Die Maus soll dich ficken.“ Das haben die sofort an das norwegische Fernsehen weitergegeben und gesagt: Der Mann hat unsere Mütter beleidigt.
Sind Sie diesmal vorbereitet?
Man kann sich nicht vorbereiten. Bei der „Winterlichen Reise“ war mir schon klar, dass es was geben wird. Aber man kann sich nicht vorstellen, was es gibt. Es ist immer anders. Es ist immer monströser. Man will sich stellen, aber man weiß nicht, wie man das macht. Man kann ja auch nicht blöd grinsen.
Einer der letzten Literaturnobelpreisträger vor Ihnen war Bob Dylan. Behagt Ihnen die Nachbarschaft?
Das ist ein ganz großer, ewiger Sänger. Das ist klar. Aber der Preis war eher eine Verspottung des Lesens. Literatur ist Lesen.
Leute, die Sie verteidigen, sagen, man müsse das Werk vom Autor trennen. Ist das denn möglich?
Ich bin nicht einer, der sagt, einem Schriftsteller ist alles gestattet. Der kann ruhig auch zwielichtig sein. Nein. Ich bin dafür, dass ein Schriftsteller versucht, auch als Mensch gut zu sein. Anders geht das nicht.
Auch bei Céline hat man gesagt, ein ganz Großer, aber ...
Hört doch auf! Fehlt nur noch Ezra Pound. Wer weiß? Céline war ja auch Armendoktor und hat sich dann mit dem Antisemitismus verirrt.
Man könnte sagen, auch Peter Handke hat sich verirrt.
Glaube ich nicht. Mein Spruch ist: Ich werde mich entschlossen verirren. Das steht am Ende eines Journalbandes. Es gibt nichts Fruchtbareres, als sich entschlossen zu verirren. Aber wenn das jemand zu Jugoslawien sagt, dann haue ich ihm links und rechts eine herunter. Ich habe mich im Leben ordentlich verirrt, manchmal auch mit Vorsatz, aber im Schreiben nicht. Was heißt überhaupt verirren? Es gibt ja auch Leute, die fliehen. Und manchmal gibt es Helden der Flucht. Vielleicht sind das die besten Helden von heute.
Werden Sie sich festlich kleiden?
Meine Frau hat den Plan, den sie uns zugeschickt haben. Man muss. Jeder muss. Warum auch nicht? Als ich in Alcalá de Henares bei Madrid, wo Cervantes geboren ist, an der Universität eine Art Ehrendoktor bekommen habe, hat man mir eine Perücke gegeben. Habe ich halt aufgesetzt. Jemand hat mir erzählt, Heinrich Böll wollte für die Zeremonie den Frack nicht anziehen. Aber man hat ihn dann doch dazu gebracht. Und dann war er viel zu weit. Dann hat er sich die Stulpen wie eine Jean hinaufgekrempelt. Angeblich kommt ein Schneider ins Hotel und misst einem das an. Aber nicht für die Rede. Für die Rede kann ich meinen eigenen Anzug anziehen. Ich hoffe, ich muss keine Krawatte tragen.
Werden Sie in Stockholm Leibwächter bekommen?
In Oslo beim Ibsen-Preis waren es fünf. Das Spalier der Demonstranten war, wie man früher gesagt hat, ein Spießrutenlauf. Geschlagen haben sie nicht. Die Leibwächter haben mich dann durch die Stadt begleitet. Es war schön mit denen: Wie wir geredet haben, wie die erzählt haben. Einer, der Kapo, hat mir erklärt, welche Gegner er ins Auge gefasst hat, welche Frau, welchen Mann, und wo die tätlich werden könnten. Der hat mir beschrieben, wie er das gesehen hat. Irgendwann schreibe ich noch ein Theaterstück, wie Leibwächter die Menschen sehen.
Sie könnten zu den Demonstranten hingehen und sagen, hört doch zu, was ich sagen will.
Hören Sie auf! Ich hoffe, dass einmal eine große Prozession aller Taugenichtse in meiner Allee in Chaville stehen wird, mir Olivenöl und Trüffeln oder sonst was zu Füßen legt. Ich warte.
