Der Lockdown zeitigt Nebeneffekte. Letzten Sonntag rangierte Albert Camus’ „Die Pest“ unter den 17 meistverkauften Büchern auf Amazon, bei den „Klassikern“ gar auf Platz 1. Erschienen 1947, zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, beschreibt der Roman eine Pestepidemie in der algerischen Stadt Oran. Das Werk gilt als Allegorie auf die Nazi-Okkupation Frankreichs; Camus selbst, heißt es, wollte es als Parabel auf das Grauen des Krieges verstanden wissen, das alle Übereinkünfte menschlichen Zusammenlebens infrage stellt.
Amazon-Kunden, die sich einen griffigen Seuchen-Thriller erwarten, werden also eventuell enttäuscht sein von „Die Pest“. Und machen doch eine Leseerfahrung, die kaum zeitgemäßer sein könnte. Nicht nur, weil darin – eine Stadt wird abgeriegelt, in Schulen stapeln sich Särge, die Opfer sterben allein und werden hastig verscharrt – vertraut gewordene Schreckensbilder auftauchen. Der zentrale Konflikt verläuft zwischen individuellen Bedürfnissen und der moralischen Verpflichtung, im Sinne der Gemeinschaft zu agieren: Die Bösewichte des Romans sind diejenigen, die der Pest um jeden Preis zu entkommen oder Gewinn aus ihr zu schlagen versuchen. Wer unfähig ist, sein Eigeninteresse zu überwinden, wird blind für solidarisches Handeln, argumentiert Camus. Oder: Wer es nicht schafft, in der eigenen die kollektive Erfahrung zu erkennen, dem fehlt der Sinn für das Gemeinwesen.
Genau darum geht es auch in der aktuellen Diskussion. In der Coronakrise wird Milliarden Menschen abverlangt, über den Horizont ihrer Individualbedürfnisse hinaus zu blicken. Und obwohl die Gleichung eine schlichte ist – wer Rücksicht übt, senkt das Risiko für alle –, ist die Bewältigung dieses „größten Stresstests für unser Zusammenleben“ (Sascha Lobo im „Spiegel“) schwieriger als gedacht. Solidarität: harte Bandage.
Das zeigt sich nicht nur an den internationalen Höchstbietergefechten um größere Schutzmaskenbestände. Oder an den reichen Russen, die angeblich massenhaft in Spitälern benötigte Beatmungsgeräte aufkaufen. Das zeigt sich auch, wenn die Beschwörungen, doch bitte zu Hause zu bleiben, hartnäckig als Gleichschaltungsversuch missverstanden werden und das – eh legitime – Unbehagen an Verordnungen, die persönliche Bedürfnisse einschränken, ein Verhalten motiviert, das sich selbst als widerständig erlebt, während es in Wahrheit bloß unsolidarisch ist.
Einkaufen gehen, Freunde treffen, Spaziergänge in gut frequentierten Parks zählen zu den individuellen Freiheiten, die derzeit zugunsten des Gemeinwohls pausiert werden müssen, weil das Virus alle gleich angeht: Junge, Alte, Reiche, Arme, Robuste und Verletzliche. Wer selbst nicht erkrankt, kann trotzdem Verbreiter der Krankheit sein; wer das missachtet, heißt neuerdings Gefährder. Während Soziologen sich bereits über die zunehmende „Denunziationsbereitschaft“ Sorgen machen, bewegt der Solidaritätsdruck manche Politiker zu fast philosophischen Beschwörungsformeln: „Love has to be smarter than reactive“, appellierte jüngst Andrew Cuomo, Gouverneur des von Corona schwer getroffenen US-Bundesstaates New York, an seine Bürger: Nächstenliebe heißt, sich aktiv aus seinen Komfortzonen hinauszubemühen.
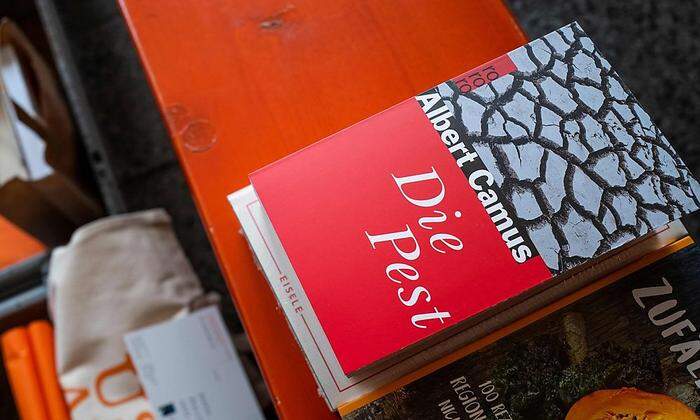
Bei Camus entkommt keine Romanfigur der Krankheit. Aber wer sich ihr entgegenstellt, um die Leiden ihrer Opfer zu lindern, hat die Chance, das Grauen am Ende zu überleben. Auch das ist natürlich eine allegorische Botschaft: Moralisch unbeschadet überstehen lassen sich Katastrophen nur durch Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Auch wenn nach Camus die menschliche Existenz absurd, weil sinnlos ist, erhält das Leben Bedeutung, wenn man sich dem gleichgültigen Universum und den Leiden, die es verursacht, entgegenstemmt. Insofern zeigen Krisen wie die aktuelle, wie wichtig Anstand und Solidarität für das menschliche Zusammenleben sind.
Dass „Die Pest“ von der Notwendigkeit der gemeinsamen Anstrengung zur Überwindung von Katastrophen erzählt: herbe Lektion für eine auf kollektive Risikominimierung und maximierten individuellen Lustgewinn fixierte Gesellschaft. Immerhin endet der Roman halbwegs hoffnungsvoll. Als die Seuche besiegt ist und in der Stadt die Freudenfeuer steigen, zieht der Pestarzt Rieux aus den überwundenen Heimsuchungen den Schluss, „dass es an den Menschen mehr zu bewundern als zu verachten gibt“, weil sie „trotz ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens und seine unermüdliche Waffe ankämpfen“: Gemeinwesen können dank kollektiver Anstrengung gestärkt aus Krisen hervorgehen. Während die Corona-Pandemie uns gerade vor Augen führt, dass jede Einzelhandlung das Wohl anderer Menschen beeinflusst, beschwört Camus’ Roman die Bedeutung von Werten wie Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Solidarität. Insofern ist der gut 70 Jahre alte Roman nicht nur ganz schön zeitgemäß. Er tröstet auch.
Ute Baumhackl
