Genialer Schurkenstreich
Es sollte sich herumgesprochen haben, aber es schadet ja nicht, das Lob und die Anerkennung zu wiederholen: Juri Andruchowytsch zählt zu den wichtigsten und außergewöhnlichsten europäischen Autoren der Gegenwart, ausgestattet mit einem schier unerschöpflichen Vorrat an Phantasie und Fabulierfreude. Aber man sollte sich nie täuschen lassen, denn dahinter steckt sehr viel subversive Kraft. Seine Ironie ist staubtrocken, sein Galgenhumor, den er wohl auch braucht, um nicht an den politischen Zuständen in seiner ukrainischen Heimat zu verzweifeln, ist derzeit ziemlich einzigartig. Und dieser Galgenhumor prägt, sogar in doppelter Hinsicht, sein jüngstes Werk, „Die Lieblinge der Justiz“. Als „parahistorischen Roman in achteinhalb Kapiteln“ bezeichnet Andruchowytsch seine Streifzüge durch die Jahrhunderte und durch den Paragraphendschungel, wobei seine Sympathie meist den Ganoven, Banditen und sonstigen Gesetzesbrechern gilt (sieht man von der Geschichte über die Nazi-Massaker ab). Mit souveräner Selbstverständlichkeit rekonstruiert er frei erfundene Fälle und Schandtaten, beruft sich mit strenger wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit auf historische Quellen und verhilft zum Beispiel dem Frauenmörder Blaubart zu scheinbarer Existenz, samt Hinrichtung Selten gelingt es einem Autor, so mühelos und raffiniert Dichtung und Wahrheit durcheinander zu wirbeln. Ein fintenreiches, hinterlistiges, auch makabres Glanzstück, ein genialer Schurkenstreich, der dem magischen Realismus zu neuer Präsenz verhilft. Klares Urteil: lesenswert, unbedingt.
Juri Andruchowytsch. Die Lieblinge der Justiz. Suhrkamp, 299 Seiten, 23,70 Euro. Aus dem Ukrainischen von Sabine Stöhr.

Die Welt als Insel
„Wenn die Welt in Flammen steht, vergisst man leicht, dass es Eis gibt.“ Ein markanter Satz, der sich wie ein Leitmotiv durch den Debütroman der dreißigjährigen englischen Autorin Katie Hale zieht. Aber keine Bange. „Mein Name ist Monster“ könnte durchaus in die Schubladen diverser Endzeitszenarien passen, wären in dieser von „Robinson Crusoe“ inspirierten Story nicht immer wieder Passagen zu finden, enorm reich an Poesie, Empathie und Zartheit, die eben in gar keine apokalyptische Schublade passen. Eine junge Frau, die von ihrem Vater den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Monster“ erhielt, überlebt ein weltweites Inferno durch die rechtzeitig geglückte Flucht – sie führt allerdings nach Spitzbergen, also mitten hinein in die Arktis. Als sich dort die Überlebens-Chancen auf ein Minimum reduzieren, fährt sie in ihrem Boot südwärts und landet auf einer schottischen Insel. Menschenleer, ausgestorben, wie es scheint, ehe sie ein halb verhungertes Mädchen entdeckt. Schritt für Schritt kommen die beiden sich näher, gemeinsam werden sie zu Überlebenskämpferinnen, die junge Frau schlüpft in die Rolle einer Mutter, den Namen Monster gibt sie, durchaus zärtlich gemeint, ihrer neuen, anfangs mysteriösen Weggefährtin. Katie Hale gelingt eine große literarische Komposition; archaische Wucht wird abgelöst durch wunderbare Naturschilderungen und Rückblenden auf das ohnehin desolate Leben in einer pseudo-zivilisierten, nicht mehr existenten Welt, aber stets schwingt in einer sehr poetischen, eindringlichen Melodie das Prinzip Hoffnung mit, auf einen Neubeginn, fernab von Absurdität und Unmenschlichkeit. Es ist reiner Zufall, dass dieses Buch ausgerechnet jetzt in der deutschsprachigen Übersetzung erschienen ist; kein Zufall ist es, dass es aus der Zeit der Einsamkeit und Isolation in eine Ära der Gemeinsamkeit führt. Die Brücke dorthin trägt dank Katie Hale zwei Namen: Trost und Mut.
Katie Hale. Mein Name ist Monster. S. Fischer, 384 Seiten, 22,70 Euro. Aus dem Englischen übersetzt von Eva Kemper.
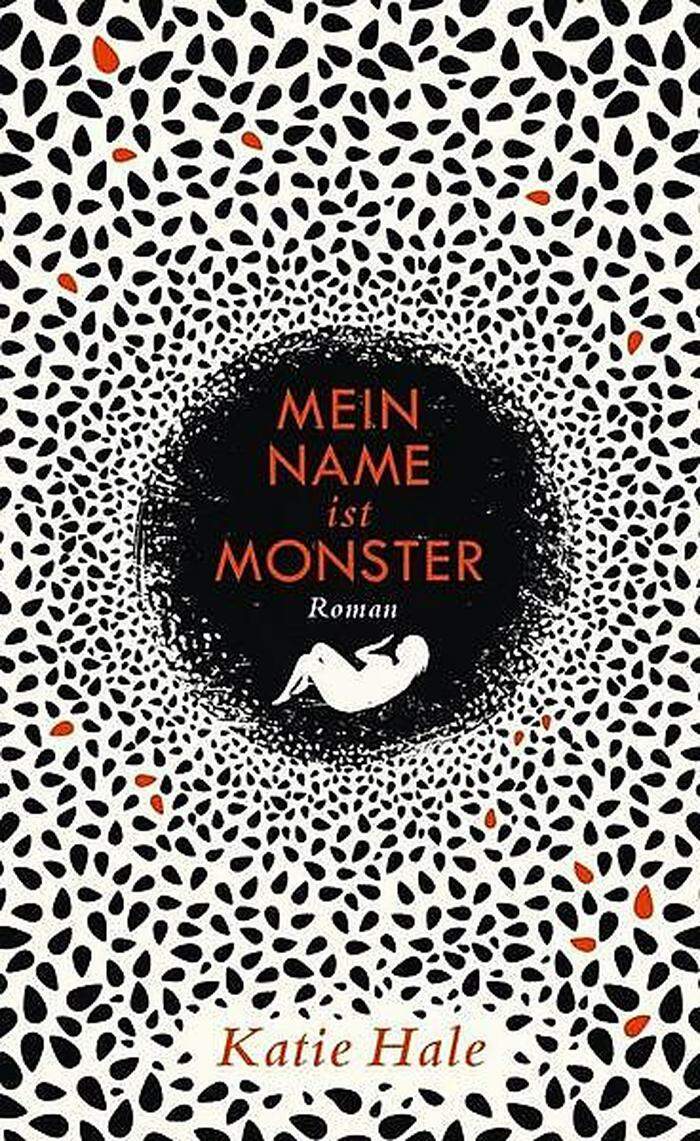
Auf Serpentinen ins Schattenreich
Belletristische Befunde über defekte Vater-Sohn-Beziehungen gibt es wie Sand am Meer. Wer da mit seiner Geschichte nicht auf halber Strecke scheitert oder sich in Oberflächlichkeit ergeht, der muss schon über ein ganz spezielles Sensorium und erzählerisches Rüstzeug verfügen. Bov Bjerg ist reichlich damit gesegnet. Seine unkonventionelle Erzählweise demonstrierte er schon in seinem längst als Kultbuch gehandelten und ausgezeichnet verfilmten Erstling „Auerhaus“ über eine Jugendlichen-WG, einer trügerisch leichten Alltags-Chronik, die zunehmend durch seelische Schatten überdeckt wird. In seinem neuen Roman „Serpentinen“ bohrt er sich tiefer hinein in dieses Schattenreich. Denn diesfalls hat der Beziehungsdefekt seinen Ursprung in schweren psychischen Nöten. „Um was geht es?“ – diese Frage zieht sich wie ein Refrain durch eine beklemmende Reise in Zonen verdrängter Erinnerungen, in deren Zentrum ein Trauma, mehr noch, ein düsterer Fluch steckt. Der Urgroßvater, der Großvater, der Vater des Ich-Erzählers und andere männliche Vorfahren verübten Selbstmord. Und dieser Erzähler hat massive Ängste, ein „Scheißvater“ zu sein, der ebenfalls vorzeitig aus dem Leben scheidet. Also fährt er mit seinem Sohn in das schwäbische Dorf, wo er seine Kindheit verbrachte. Gemeinsam mit seinem Buben will er sich noch einmal der fatalen familiären Vergangenheit stellen, um in der Gegenwart bestehen zu können. Ständig geplagt von Albträumen, permanent heimgesucht von finsteren Erinnerungen und Assoziationen. Und in all seinen Zweifeln ständig konfrontiert mit der Frage seines Sohnes: „Worum geht es?“ Das alles mag sehr depressiv klingen, und es ist logisch und naheliegend, dass Depressionen eine wichtige Rolle in diesem Trip in Schlangenlinien zum eigenen Ich spielen. Dennoch glückte Bov Bjerg eine lebensbejahende, mit einiger Ironie versehene Familiengeschichte, die ihr Ziel letztlich punktgenau erreicht: sie will, völlig kitschfrei, ans Herz gehen. Und das ist der Fall, in hohem Maße sogar. Darum geht es.
Bov Bjerg. Serpentinen. Claasen. 272 Seiten, 22,70 Euro.
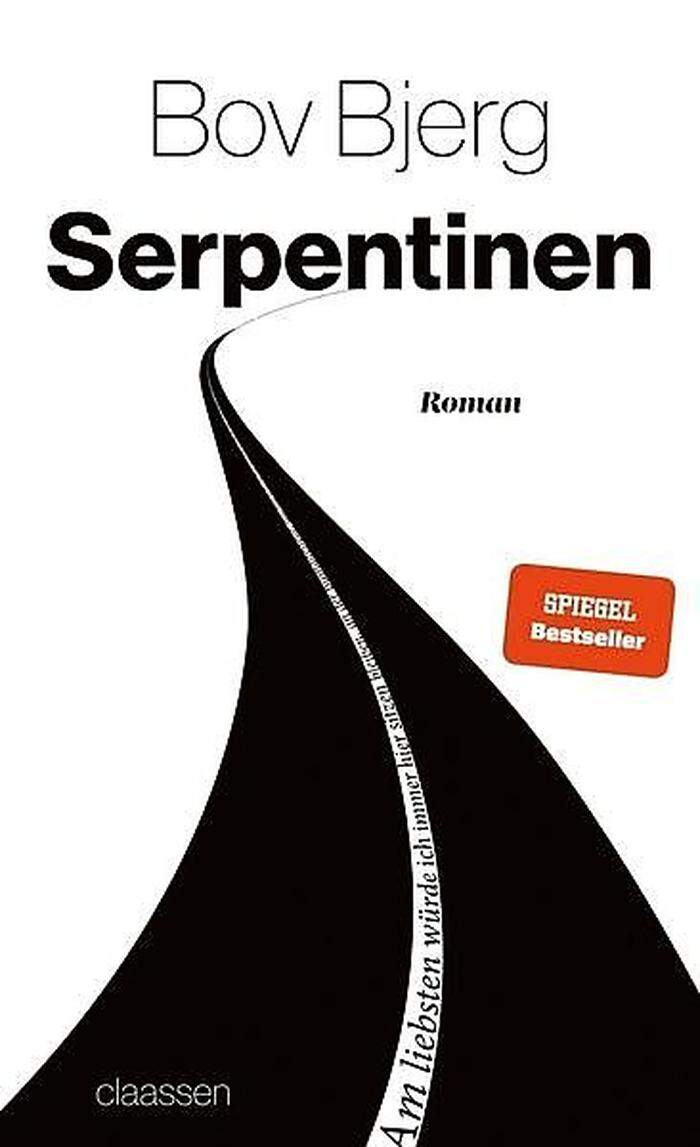
Unheimlich zeitnah
Der Klassiker-Tipp: Die Wiederbegegnung mit den Werken von Edgar Allan Poe bereitet stets unheimliche Freude. Ja, ja, das Wort „unheimlich“ passt schon. Denn es erstaunt immer wieder, wie weit dieser geniale Visionär und Wegbereiter der literarischen Moderne seiner Zeit voraus gewesen und, um einen inflationär verwendeten Begriff tatsächlich einmal ins richtige Licht zu rücken, in der Gegenwart angekommen ist. In seiner amerikanischen Heimat wurde Poe zu Lebzeiten angefeindet, er galt als Wahnsinniger, potenzieller Mörder und Alkoholiker, der wirres Zeug zu Papier brachte. Eintritt in die Weltliteratur fand er erst auf Umwegen und einige Zeit nach seinem mysteriösen Tod im Jahr 1849. Einige Jahre später, exakt 1856, begann Charles Baudelaire mit der Veröffentlichung einer insgesamt fünfbändigen Werksausgabe, die für enormes Aufsehen sorgte. Baudelaires Auswahl nützte der dtv-Verlag in einem löblichen Großprojekt für eine exzellente Neuübersetzung durch Andreas Nohl. Den2017 veröffentlichten „Unheimlichen Geschichten“, reich an Kriminalstorys, folgten nun „Neueunheimliche Geschichten“, die imposant die erzählerische Radikalität von Edgar Allan Poe belegen und in schier unfassbare Räume der Phantasie, aber auch des realen Horrors führen. Neben bekannten Geschichten wie „Der Untergang des Hauses Usher“, „Berenice“ oder „Die Fallgrube und das Pendel“ ist auch das mysteriöse Juwel „Das Zwiegespräch von Monos und Una“ zu finden, das klare Querbezüge zu Jorge Luis Borges aufweist. Unheimlich spannend, unglaublich bedeutsam.
Edgar Allan Poe. Neue unheimliche Geschichten. Herausgegeben von Charles Baudelaire. Dtv, 392 Seiten, 30,70 Euro. Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von Andreas Nohl.
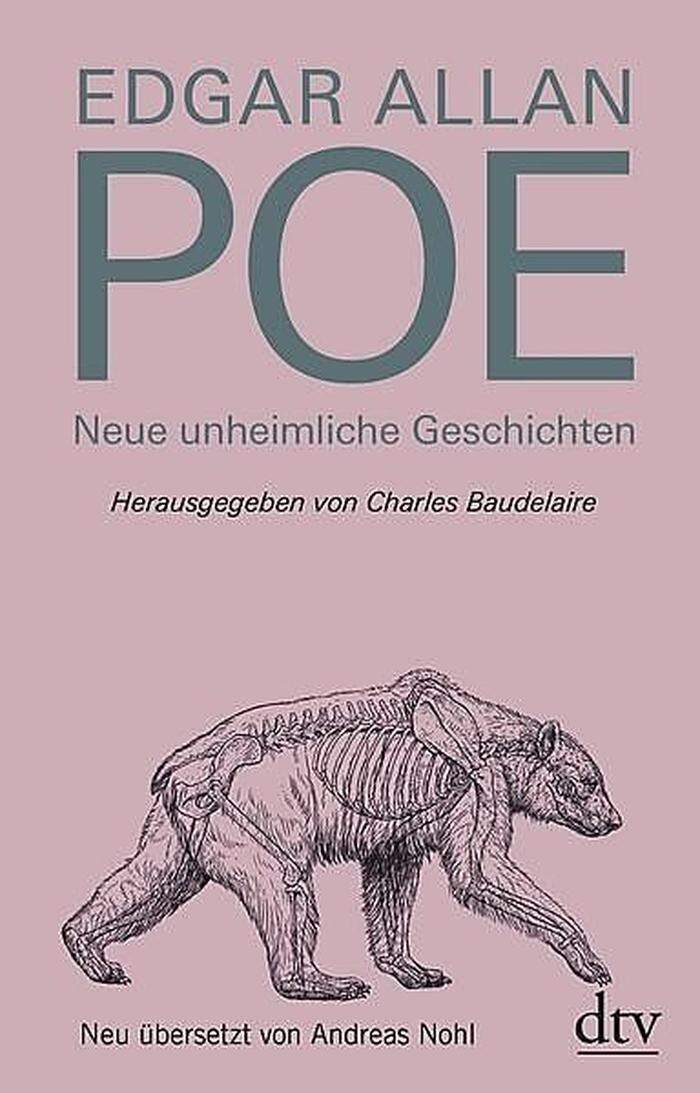
Werner Krause




