Äpfel bei Peter Handke, Glasaugen bei Valerie Fritsch, Rosenduft bei Marlene Streeruwitz ...: Ausgehend von „vermeintlichen Nebensächlichkeiten“, lieferte Gerhard Melzer ab Mai 2016 exklusiv für die Kleine Zeitung tief bohrende „Literaturgeschichten“ – Essays voll überraschender Eigenheiten in den Œuvres von 25 heimischen Autorinnen und Autoren.
Die Texte mit Feinschliff auf unseren Doppelseiten, für einen Germanistikprofessor freilich nur „Miniaturen“, wie gerade auch Gastgeber Klaus Kastberger weiß, hat Melzer nun gesammelt im Wiener Verlag Sonderzahl herausgebracht und den Band bei einem „Heimspiel“ in doppeltem Sinn vorgestellt. Erstens war der Präsentationsort „sein“ Literaturhaus Graz, das er mitinitiiert und von 2003 bis 2015 geleitet hatte. Und zweitens geriet der Mittwochabend quasi zum „Familientreffen“ der Szene: Max Droschl, Dieter Bandhauer, Markus Jaroschka, Eva Schäffer, Klaus Hoffer, Kurt Bartsch, Gerhard Fuchs, Karla Kowalski, Karl Heinz Winkler, Heinz Rosmann, Wolfgang Lorenz, Irmi Horn, Andrea Zahlbruckner-Jaufer, Daniel Doujenis, Eberhard Schrempf, Heimo Steps, Herms Fritz, Patrick Schnabl, Annemarie und Hans Schullin ... die Schar war so groß wie bunt.
Auch das Podium war hochkarätig besetzt, mit einem Trio, das Melzer – übrigens vor zwei Wochen angeblich 70 geworden – selbstredend zu seinem „subjektiven, persönlichen Kanon“ der österreichischen Literatur zählt, den er im Buch vorlegt. Andreas Unterweger, Autor und Mitherausgeber der Zeitschrift manuskripte, fungierte als Moderator und unterstrich, dass man sich durch so hochqualitative Textinterpretationen wie jene Melzers „gelesen, gesehen, erkannt fühlt wie nie“ und diese „selbst Dichtung sind“.
Valerie Fritsch steuerte mit ihrer 40 Jahre alten Polaroidkamera rätselhafte erzählerische Fotos zu den 25 Essays bei. Für die ein künstlerisches Doppelleben führende Grazerin „kommt jedes Bild, das aus einem Text entsteht, als erfundene Essenz daher“.
Und Barbara Frischmuth, in deren literarischer Menagerie Melzer „Ein Narrenschiff voller Tiere“ entdeckte, las zum Beweis und als „Gegenleistung“ zwei Texte, in denen Pferde eine Rolle spielen – darunter das ganz frühe „Traben“, eine köstliche Fachsprachenlitanei von der Rennbahn.
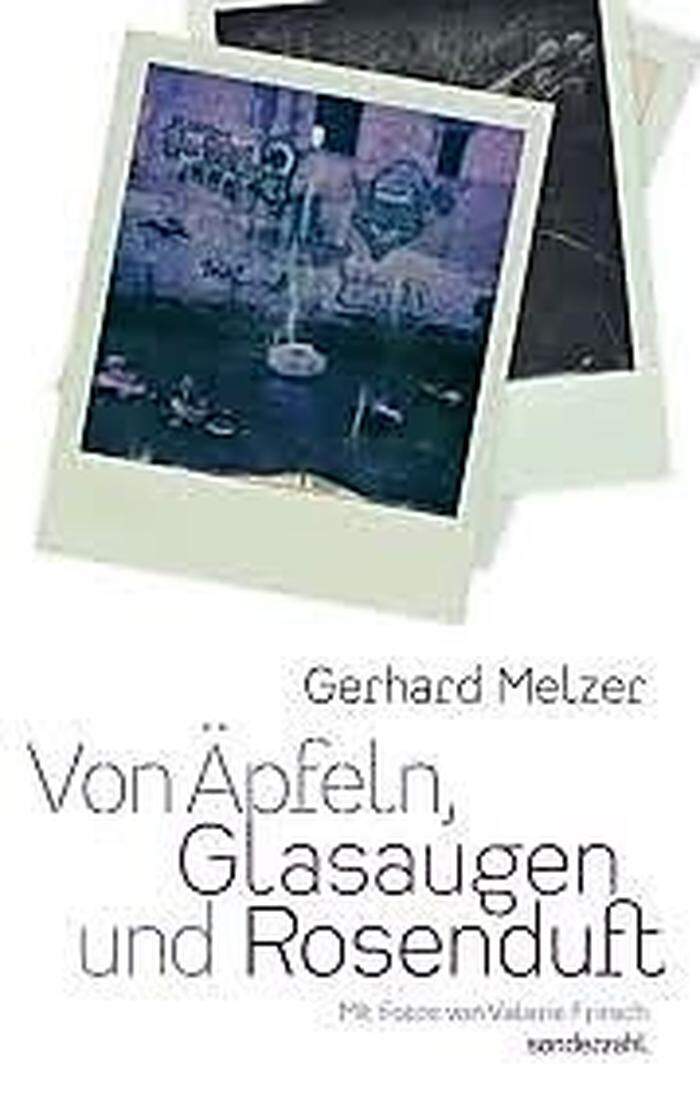
Wenn den Dingen Haare wachsen
Gerhard Melzers "Literaturgeschichte Nr. 25:
Klaus Hoffer und das Drama der Entfremdung.
Das schmale, aber gewichtige Werk von Klaus Hoffer steckt voller Dinge. Es sind Dinge des Alltags, unscheinbare Gegenstände und Gerätschaften, die stets ein wenig wirken, als seien sie aus der Zeit gefallen: ein Hobel, eine Werkzeugkiste, eine Nagelschere, ein Einsiedetopf, eine Blechdose mit Kochschokolade, ein Regenschirm. Harmlos und selbstverständlich muten diese Dinge an, doch der Eindruck trügt. Die Gegenstände in Hoffers Werk entziehen sich. Obwohl manche von ihnen mit ihren Nutzern geradezu verschmelzen, bleiben sie auf irritierende Weise unverfügbar. Sie sind präsent, aber auf Abruf.
Das rührt letztlich von der Grunderfahrung einer himmelstürzenden Fremdheit her, die Hoffers Werk durchgehend bestimmt. Fremd und unverfügbar wie die Welt sind auch die Dinge dieser Welt. So vertraut der Umgang mit ihnen zuweilen sein mag: Auf Dauer schafft er kein Weltvertrauen. Mit seinem zweiteiligen Roman „Bei den Bieresch“ übersetzt Hoffer die Erfahrung dieser heillosen Entfremdung in eine Parabel, die an Kafka erinnert. Wie Kafkas verstörte Helden sieht sich der Ich-Erzähler Hans in eine Welt verschlagen, die er bis zuletzt nicht versteht.
Es ist eine hermetische, zeitentrückte Welt, ein in sich selbst versponnenes Paralleluniversum, in das Hans wider Willen gerät. Einem archaischen Brauch folgend, muss er die Stadt, wo er bisher gelebt hat, verlassen und im Dorf Zick, einem ärmlichen Ort im Osten des Landes, ein Jahr lang die Rolle seines verstorbenen Onkels übernehmen. Er wohnt bei der Tante und arbeitet wie der Onkel als Postbote. Nach und nach ziehen ihn die Dorfbewohner in den Bann ihrer seltsamen Lebensformen, Wertvorstellungen und Mythen und verpassen ihm schließlich sogar einen neuen Namen.

Was die Dorfgemeinschaft als gelungene Integration begreift, erlebt er selbst als Enteignung, und die erreicht ihren bitteren Höhepunkt, als auch noch auf sein Hab und Gut zugegriffen wird. In Zick wird Armut als zweite Natur hingenommen. Entsprechend wächst sich der systematische Entzug von Besitz, eine Art legalisierter Diebstahl, zum lebensbestimmenden Prinzip aus. Hans dagegen erfährt diesen Entzug als fatalen Realitätsverlust, der die Auslöschung seiner alten Identität besiegelt. Dabei verlieren auch die Dinge ihre Bodenhaftung. Ihrer Selbstverständlichkeit entkleidet, strahlen sie, wie Hoffer im Essay „Pusztavolk“ ausführt, eine „Aura des Unwirklichen, Eingebildeten, Vorgetäuschten“ aus und entwickeln dabei „ein gespenstisches Eigenleben“.
Da ist etwa von einer emaillierten Dose die Rede, die ein Dörfler aus der Lade seines Verkaufspults holt. „Was wohl da drin sein mag?“, fragt er und mutmaßt: „Stecknadeln?“ Doch statt nachzusehen, schüttelt er die Dose und legt sie ungeöffnet wieder zurück. Wo Entzug droht, stellt sich von vornherein kein Bezug her, und so bleiben viele Dinge in Zick rätselhaft entrückt. Ihr abgründiges Eigenleben ist Teil der großen Fremdheit, in die Hoffers Protagonist verstrickt wird. Der Sog dieser Fremdheit wirkt übermächtig, trotzdem rumort in Hans ein Rest von Eigensinn. Der manifestiert sich nicht in konkreten Handlungen, sondern auf Umwegen, als geheime Zwiesprache mit einem besonderen Exemplar der Dingwelt. Es ist ein Ding, so treffend gewählt und mit Bedeutung aufgeladen, dass es das ganze Drama der Entfremdung ins Bild fasst.
Über weite Strecken des Romans ist Hans mit einer Scheibtruhe unterwegs. Sie scheint ihm als Attribut zugeordnet wie der Bischofsstab den Bischöfen in Darstellungen des christlichen Mittelalters. Vordergründig ist sie das anachronistische Vehikel, mit dem der neue Postbote die Briefe befördert, die er zuzustellen hat. Darüber hinaus fungiert sie erkennbar als „Transportmittel“ höherer Ordnung. Ihre Griffe haben die Form ausgestreckter Hände, und damit tut sich ein Bedeutungsraum auf, in dem das Spiel der Hände zum Indiz sozialer Beziehungen und Beziehungsstörungen wird. Die ausgestreckte Hand kann das Bedürfnis nach Zuwendung, Bindung und Gemeinsamkeit anzeigen, aber auch unerwünschte Zu- und Übergriffe.
So gesehen, liegt es im wahrsten Sinn des Wortes auf der Hand, dass Hans seinen Zwangsaufenthalt in Zick als einzigen Zu- und Übergriff empfindet. Und mit einem unbewussten Akt der Notwehr reagiert, als er merkt, dass ihm sogar die eigene Erinnerung ausgetrieben werden soll. „Ohnmächtig vor Zorn“ umklammert er die „Hände“ der Scheibtruhe und packt dabei so fest zu, dass die beiden Daumen von den Holzgriffen abbrechen. Der Vorgang gerät zum Sinnbild für die tiefe Kluft, die Hans und die Dorfgemeinschaft trennt, und auch sonst sind es immer wieder verhaltene, eingeschränkte oder aggressive Artikulationsformen der Hand, die von Entzweiung und Entfremdung künden.
Die Fremdbestimmung, die ihm widerfährt, macht Hans krank. Zu den Symptomen dieser Krankheit gehören starre Arme und Finger „wie zu Krallen verkrampft“. „Meine beiden Hände waren fest zu Fäusten verschlossen“, beschreibt er seinen Zustand, „in ihnen steckten die Daumen wie zwei kleine hölzerne Kegel.“ Was hier Ausdruck von Schwäche ist, kann auch unterdrückte Feindseligkeit signalisieren. Dann mag aus der verschlossenen die geballte Faust werden, etwa wenn Hans das Scheitern seiner Beziehung zu Maria rekapituliert. Sie seien, „die Hände wie zur Sicherheit im Rücken oder in den Hosentaschen zu Fäusten geballt, ziellos im Hof auf und ab marschiert“ und hätten „bloß mit abweisenden Blicken Antwort gegeben, jeder mit seinem in ihm verschlossenen Abgrund“.

Geschlossene oder geballte Fäuste markieren das Gegenteil der ausgestreckten Hand. Die mutiert ihrerseits zur Waffe, wo sie nicht Brücken schlägt, sondern zum Schlag ausholt. Die fremde Welt des Dorfes nimmt Hans wahr, als hätte er von ihr „Ohrfeigen“ zu erwarten, selbst ein Scheunentor erscheint ihm wie eine drohend erhobene Hand. Diese Drohung kulminiert im Bild der „Riesenhand“, der er nicht ausweichen kann. Sie greift nach seinem Kopf und drückt ihn unter Wasser. Ähnlich stellt sich dem Ich-Erzähler des Fragments „Am Magnetberg“ sein radikales Fremdsein in der Welt als ausweglose Krankheit dar, die immer nur für Augenblicke ihre Hand von ihm nimmt, „um sie zu wechseln und mit der anderen auszuholen – zu einem doppelt festen Schlag“.
Bei aller Unausweichlichkeit, die Hoffer mit masochistischer Gründlichkeit ausmalt, tun sich da und dort zaghaft Gegenwelten auf. Sie verheißen die Überwindung der Entfremdung, und es kommt nicht von ungefähr, dass dabei Nähe und Zutrauen zu den Dingen eine entscheidende Rolle spielen. „Ich hatte das Gefühl, als wären allen Dingen mit einem Male Haare gewachsen, durch die ich mit meinen Fingern fahren wollte“, kennzeichnet Hans das glückhafte Gelingen einer Freundschaft, und die ausgestreckte Hand ist unter solchen Vorzeichen eine, die nicht zugreift, sondern ergriffen werden will. Statt zu drohen verspricht sie Halt und Orientierung.
Angesichts des rundum schwankenden Bodens, auf den Hans in Zick trifft, wächst dem Ineinander der Hände, der zärtlichen Berührung, geradezu utopische Qualität zu, die selbst auf die Holzhände der Scheibtruhe abstrahlt: Hans will wahrhaben, dass sie ihn „oberhalb der Ellbogen“ umfassen und halten, „damit ich nicht hinfiel“.
Zumindest in der Vorstellung entziehen sich die Dinge nicht, sondern stiften Vertrauen und belastbare Bezüge. Im Fragment „Am Magnetberg“ ist es ein Boot, das für den Ich-Erzähler einen mütterlichen Raum der Geborgenheit bereithält. In Wirklichkeit umgeben vom Dunkel äußerster Isolation und Entfremdung, ist es im illusionären Boot „warm“ und „windstill“: „In seiner Bäuchung / lag ich, / atmend, / fortgetragen von den Schlägen / des Herzens.“
Michael Tschida
