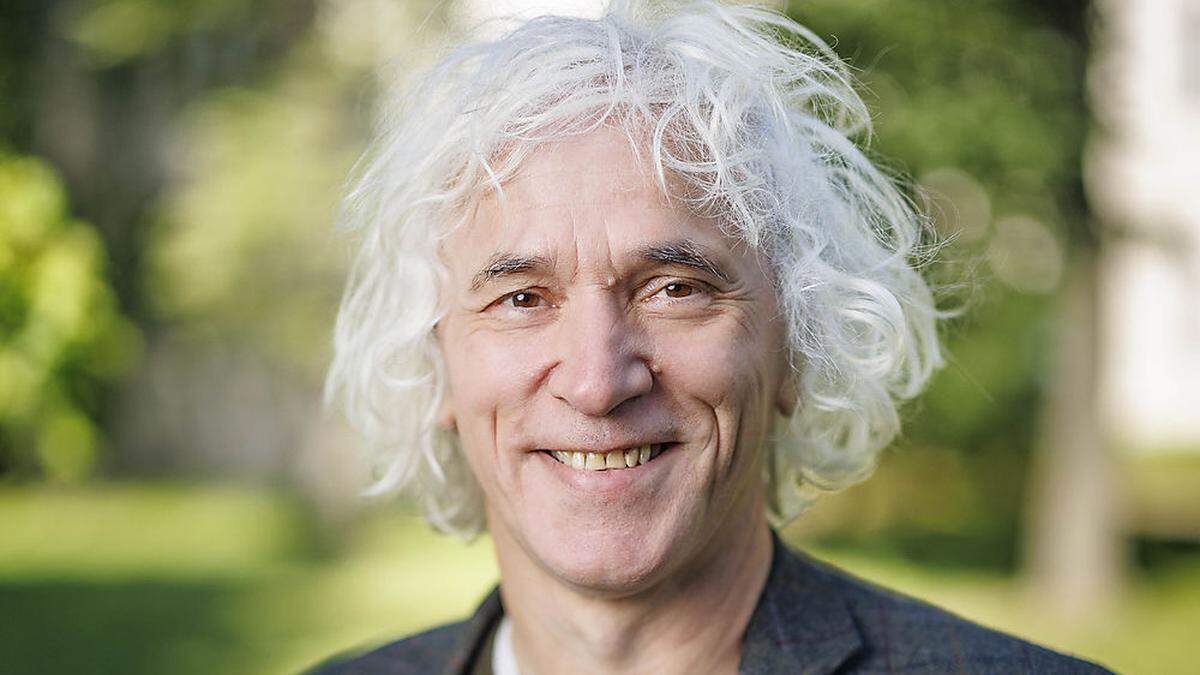Sie sind einer der renommiertesten Forscher Österreichs. Sogar ein Asteroid ist nach Ihnen benannt. Ihr Forschungsschwerpunkt: genetische Ursachen von Krankheiten. Sie sind nach vielen Jahren in Kanada wieder zurück. Was hat Sie wieder nach Europa gebracht?
JOSEF PENNINGER: Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Dort gibt es Bedingungen, durch die ich als Leiter wirklich was voranbringen kann. Da geht es nicht nur um einen Hero, der eingekauft wird, es geht um ein ganzes Team. Wie bei Marcel Hirscher: Es brauchte auch 100 starke Leute im Hintergrund, damit er gewann. Ich will Helmholtz in Deutschland zum größten und besten Zentrum für Infektionsbiologie der Welt ausbauen.
Und wieder hat es Österreich verbockt, Sie im Land zu halten?
Ich habe eine 25-Prozent-Professur an der MedUni Wien, wo ich mithelfen werde, das Eric-Kandel-Institut für Präzisionsmedizin aufzubauen. Auch hier habe ich den Anspruch, in der Grundlagenforschung zur Weltklasse gehören zu wollen. Das ist mir allein schon wegen Eric Kandel ein persönliches Anliegen, der mein Mentor war. Das Institut liegt mir wirklich am Herzen, aber ich spiele schon auch gern in der großen Liga und mit Helmholtz ist das möglich.
Neurowissenschaftler Eric Kandel, der 1939 aufgrund seiner jüdischen Herkunft von den Nazis aus Wien vertrieben wurde, sagte einmal: "Als ich den Nobelpreis bekam, wollten ihn viele Österreicher für sich reklamieren. Da musste ich einigen erst erklären, dass ich Amerikaner bin."
Eric Kandel hat mir gegenüber einmal erwähnt, dass er nie wirklich gefragt wurde, ob er in Österreich arbeiten möchte. Ich glaube, das war die zweite Tragödie für Österreich, nach der Vertreibung dieses Menschen. Ich stelle mir immer vor, wie es gewesen wäre, wenn Eric Kandel 1950 nach Österreich zurückgekommen wäre: Ich behaupte, wir hätten ein komplett anderes Österreich. Ich hatte erst vor Kurzem einen Nachmittagskaffee mit Eric in New York. Ich war bei ihm in der Wohnung. Er wird ja schon 94. Erst jetzt ist er in Pension gegangen, weil er keine Grants, also keine Forschungsförderung mehr bekommen hat.
Zu seinem 90er wurde Kandel gefragt, warum er nicht, wie in Österreich üblich, mit 60, 61 in Pension gegangen sei. Kandel antwortete: "In den USA ist man mit 61 ein Kind. Ich arbeite Vollzeit, werde Vollzeit bezahlt."
Ich kann mir das Leben auch nicht anders vorstellen. Es gibt noch so viele Dinge zu tun.
In Österreichs Regierungserklärungen wird Forschung immer hochgehalten: Deckt sich das mit der Wirklichkeit?
Ich kann nicht sagen, was die letzten Jahre los war, da war ich in Kanada, aber der letzte Schub, den ich miterlebt habe, ist lange her. Das war Anfang der 2000er-Jahre, als Wolfgang Schüssel den Zwei-Milliarden-Fonds für Forschung aufgelegt hat. Das hat einen echten Schwung gebracht. Danach gab es nur Nachbesserungen, zu wenig, um mit der Weltspitze mitzuhalten. Wenn man die Besten haben will, muss man ihnen auch eine Perspektive geben. Es bräuchte Förderungen für biomedizinische Forschung, seit Covid-19 wissen wir, wie wichtig das ist. Denn es ist, wie ein Freund von mir sagt: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.
Sie gelten nicht nur als gescheit, sondern auch als fleißig: Auf wie viele Wochenarbeitsstunden kommen Sie?
70, 80 Stunden sind normal. Wochenende gibt’s auch nicht wirklich, weil ich letztlich immer erreichbar bin. Ich habe ja auch noch ein Labor in Kanada und kleinere Biotech-Firmen, aber man lernt auch, wie man alles unterbringt.
Mit Work-Life-Balance können Sie nichts anfangen?
Nein, nicht wirklich. Die Arbeit ist einfach mein Leben. Ich habe meine Karriere auch nicht geplant, habe mich auch nie irgendwo beworben. Ich wurde eher angesprochen. Meine Eltern waren stinksauer, als ich sagte, dass ich Wissenschaftler werden will. Meine Mutter wollte, dass ich Hausarzt werde.
Sie sind im Innviertel mit zwei älteren Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen?
Genau. Ich hatte zehn Jahre lang eine wunderschöne Kindheit. Wir hatten einen kleinen Bauernhof. Mein Vater ist um fünf in der Früh auf, hat die Kühe gefüttert, dann ist er zur Arbeit. Er war bei der Straßenmeisterei. Am Nachmittag ist er wieder heim und hat weitergearbeitet. Als ich zehn war, hat sich meine Mutter eingebildet, Wirtin zu werden. Die Eltern haben ein kleines Gasthaus gekauft und ich wurde ins Internat geschickt. Ich kam in ein katholisches Internat, in ein Konvikt. Das war für jemand wie mich, der stundenlang nur im Wald war und mit Kühen redete, ein beinharter Schnitt. Aber ich habe gelernt, zu überleben.
War das auch ein Motor?
Vielleicht bin ich da, wo ich bin, weil ich durch eine knallharte Schule gegangen bin. Man darf auch nie vergessen, woher man kommt. Ich habe bei meinen Sommerjobs auf dem Bau spannende Menschen kennengelernt, die zwar keine große Schulbildung hatten, aber ein großes Interesse an der Welt. Nur weil man einen Titel hat, ist man nicht klüger als jemand, der im Dorf geblieben ist. Ilya Prigogine, der den Nobelpreis für die Chaostheorie bekam, hat gesagt, dass man das Leben eines Menschen mathematisch beschreiben kann: Jeder Mensch kommt an Kreuzungen, und entweder biegt er rechts oder links ab, und je nach Richtung entwickeln wir unseren Lebensbaum. Jeder Mensch hat viele Möglichkeiten, abzubiegen. Und hätte ich mehr Talent gehabt, wäre ich Fußballer in irgendeiner zweiten Liga in Österreich geworden.
Wie ist das mit dem Fußball?
Ich wollte Profifußballer werden. Zwei meiner Freunde aus Gurten haben’s auch geschafft, Union Gurten ist heute eine der besten Fußballmannschaften Österreichs (lacht). Ich habe trainiert wie blöd. Dann habe ich mir alle Bänder im Fußgelenk gerissen und hatte eine Fraktur, konnte ein Jahr nimmer gehen. Dann kam Plan B: Gut, dann gehe ich eben studieren.
War Medizin immer klar?
Nein, nie. Mein Hirn funktioniert ja eigentlich nur mathematisch. Wenn ich auf der Straße gehe, dann fange ich zu zählen an. Die Meter und die Schritte und die Bäume. Ich brauche einfach immer Zahlen. Ich wollte eigentlich Mathematiker werden. Ganz schwer habe ich mir in Deutsch getan. Erst später habe ich herausgefunden, warum: Ich war Legastheniker. Ich habe einfach nicht kapiert, wie man ein Wort schreibt. Das war im Gymnasium nicht ganz gut.
Wie kamen Sie zur Medizin?
Ich bin kurz vor der Matura in Ried im Stadtpark gesessen, es war ein schöner Maitag, und ich dachte mir: Ich muss die Welt retten. So kam ich zur Medizin. Aber geplant war es nie.
Ihre Mutter lag nach einem Schlaganfall im Wachkoma: Was hat das mit Ihnen gemacht?
Es war furchtbar. Acht Jahre lang. Sie lag mit einer Magensonde in einem Pflegeheim. Mein Vater ist jeden Tag zu ihr hin und hat ihr stundenlang die Zeitung vorgelesen. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Meine Kinder haben meine Mutter nur im Bett liegend kennengelernt.
Bei einem Vortrag im Gymnasium in Ried sagten Sie einmal: "Wichtig ist, dass man tut, was man mag. Arbeitslos kann ich auch mit etwas sein, das ich nicht mag. Traut euch!" Warum ist das so?
Weil es stimmt. Jeder sollte das machen, was er gut kann. Wenn dann noch Leidenschaft dabei ist, dann ist es schon sehr schön.