Irgendwann, wann genau, steht nicht fest: Alle Brücken sind abgebrochen, Europa ist zersplittert in böse Zwergstaaten, jede Scherbe hat ihre eigene Hymne, und wenn die Quote der Ausländer zu hoch ist, werden die Ausländer deportiert in ihr Heimat-Zwergenreich. One-Way-Ticket.
Grafschaft Bandon heißt das hermetische Land, in dem Christoph Ransmayr seinen neuen Roman angesiedelt hat, und im Zentrum steht der titelgebende „Fallmeister“, eine Art Schleusenwart. „Mein Vater hat fünf Menschen getötet.“ Mit diesem reißenden Satz hebt diese Geschichte an, denn der Sohn, ein Hydrotechniker, ist überzeugt davon, dass das Kentern des voll besetzten Bootes im Weißen Fluss kein Unglück war, sondern ein Verbrechen. Begangen – ja, warum?
Das ist die erste Handlungsebene dieses Romans, in dem Ransmayr einmal mehr beweist, dass er das Sprachruder fest in der Hand hat, und er allein bestimmt, wohin die Fahrt geht. Sie führt stromabwärts, und der Wasserfall in der Grafschaft Bandon ist zwar die ursächliche, aber nicht einzige Gefahrenquelle, die in den Gewässern lauert, so viel darf verraten werden. Mehr nicht.
Eine metaphernreiche Weltreise
Wenn man diesem Großkaliber der Literatur eine Schwäche vorwerfen kann, dann ist das – so paradox das klingen mag – seine eigene Stärke. Jeder Satz sitzt, jedes Wort haftet, jede Formulierung glänzt. Und im Schatten des großen Schreibers fühlt man sich als Leser mitunter zwergenhaft.
Natürlich liefert Ransmayr nicht nur eine eindimensionale Kriminalgeschichte. Im Zuge einer metaphernreichen Weltreise, die immer in Flusslandschaften mündet, stellt er eine Frage, die nicht neu ist, aber berechtigt, weil noch immer unbeantwortet: „Wie dünn (...) war die Membran, die das Innerste eines friedlichen, Musik und Malerei und dazu Süßigkeiten, seine Kinder oder wenigstens sein Vieh liebenden Menschen von einer tief in ihm kauernden Bestie trennte?“
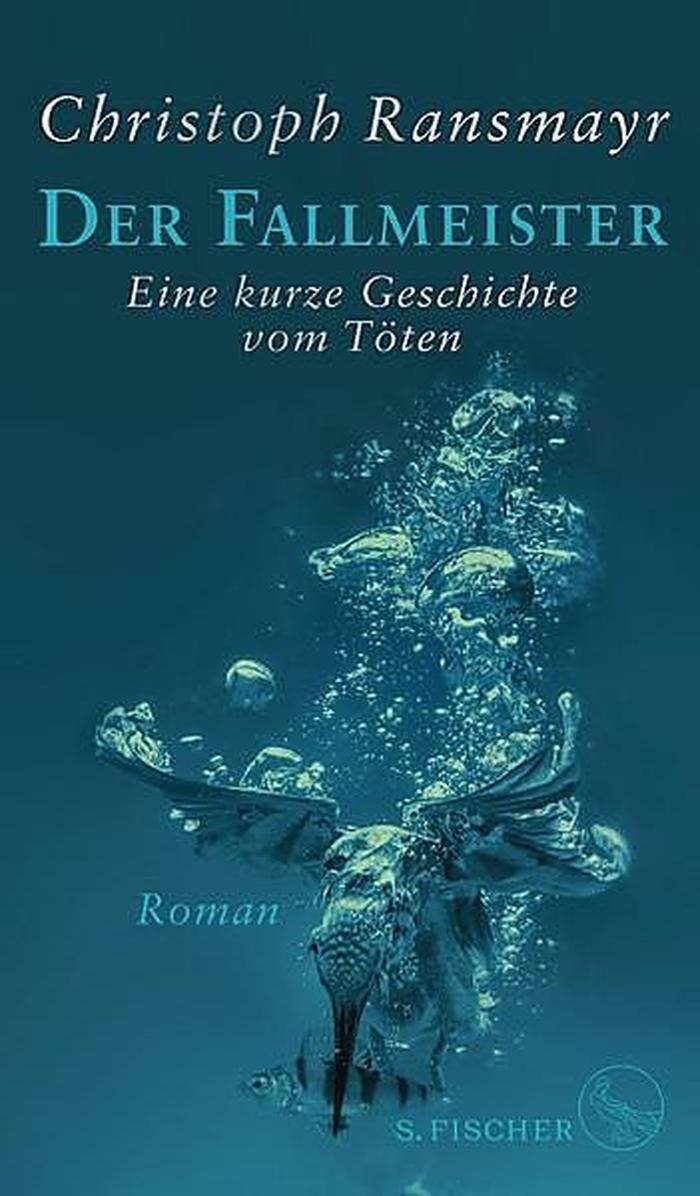
Buchtipp: Christoph Ransmayr. Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten. S. Fischer. 224 S., 22,90 €.

