"Ich möchte nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde": So eindringlich mahnte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) angesichts des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nun ein entschlosseneres Vorgehen gegen die Neonazi-Szene ein.
Passend zum Tag wurde am Freitag aus Kreisen des Bundesamtes für Verfassungsschutz bekannt, dass Rechtsextremisten in Vorbereitung auf "Tag X" 200 Leichensäcke bestellen wollten. Sie führten Todeslisten, auf denen knapp 25.000 Namen standen, hauptsächlich Personen aus dem regionalen Umfeld der "Prepper", bevorzugt Lokalpolitiker von SPD, Grünen, Linken und CDU, die sich als "Flüchtlingsfreunde" zu erkennen gegeben und Flüchtlingsarbeit geleistet hätten. Für Aufregung hatte zuletzt auch ein deutscher Polizist gesorgt, der am Rande des Neonazi-Festivals in Ostritz mit einschlägigen "Abzeichen" auf der Uniform fotografiert worden war.
Politisch motiviertes Tötungsverbrechen
Zwei Männer, über die sich der mutmaßliche Täter Stephan E. die Schusswaffe besorgt haben soll, wurden gestern festgenommen. Für ein rechtsterroristisches Netzwerk gibt es bislang keine Hinweise, die Tat gilt aber laut Staatsanwalt als "politisch motiviertes Tötungsverbrechen". Die Zahlen sind bedenklich: 24.000 bis 25.000 Rechtsextremisten gibt es laut Seehofer in Deutschland, etwa die Hälfte gilt als "definitiv gewaltbereit". Die Gefährdungslage sei "hoch", zudem sei es unmöglich, 12.000 Menschen flächendeckend zu überwachen.
Das Gros der zur Last gegelegten Straftaten sind Körperverletzungen und Propagandadelikte. Rechtsextremismus-Experte Gideon Botsch von der Uni Potsdam hält im Interview fest, dass die Ermordung des CDU-Politikers Endstufe einer Entwicklung ist, die auf dem Boden von Hass und Hetze keimt und in Gewalt mündet. "Dass es zu weiteren gezielten terroristischen Akten kommt, halte ich augenblicklich für ein sehr reales Bedrohungsszenario", sagt der Experte, der zudem Leiter der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus ist.

Laut Statistik bewegten sich in Deutschland die Zahlen für rechte Gewalt 2009 bis 2014 zwischen 700 und 800 Fällen pro Jahr. Die Jahre 2015 bis 2018 brachten die höchsten Werte, die die Opferberatungsstellen je erfasst haben – mit bis zu 1500 Einzelfällen. Die Neonazi-Gruppierung "Combat 18" (C18), zu dem der Verdächtige Kontakte hatte, ist ursprünglich der bewaffnete Arm der in Deutschland seit dem Jahr 2000 verbotenen Organisation "Blood & Honour", der als Neben- oder Unterorganisation aber vom Verbot nicht erfasst wurde. "Das sollte dringend nachgeholt werden!", fordert der Experte.
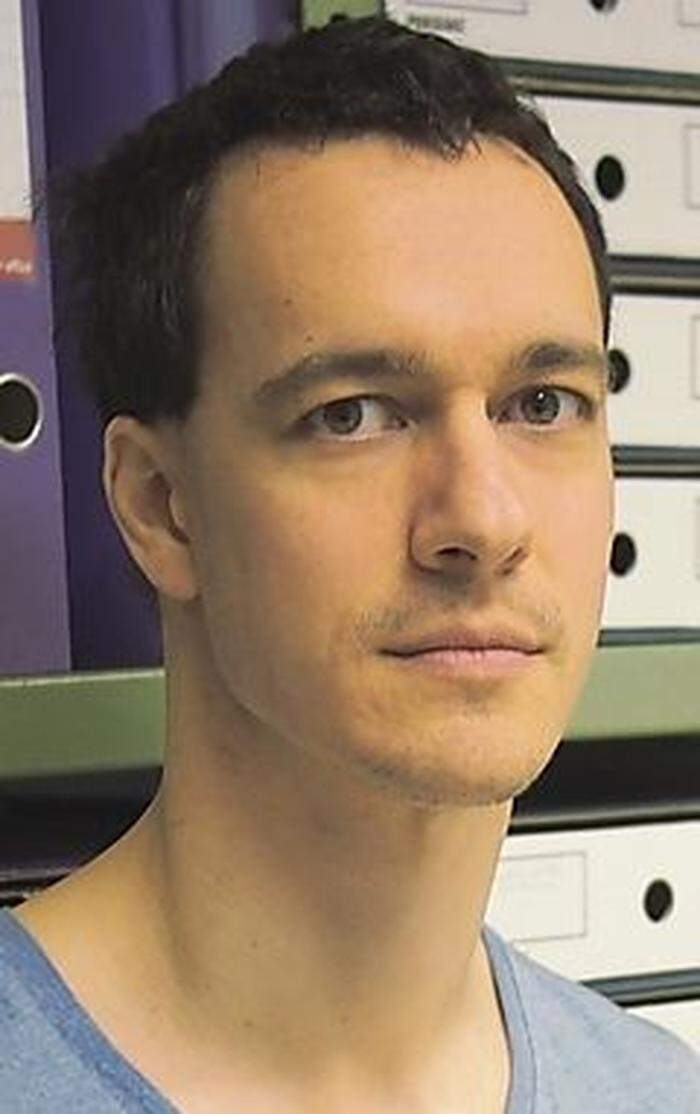
"'C18' hat eine klassische 'Vereinsstruktur' – mit Kassa, Mitgliedschaft und dergleichen. Es gibt aber auch neue Formen der Vernetzung. Einige davon sind im Internet oder über Soziale Medien schwierig zu greifen." Besonders an C18 sei die internationale Vernetzung und die Bereitschaft zu schweren Gewalttaten erkennen – sowie die Fähigkeit, einiges davon auch umzusetzen. Das Geständnis des mutmaßlichen Täters, wonach er allein gehandelt habe, "kann theoretisch zutreffen, ist aber nicht der wahrscheinlichere Fall", gibt Botsch sein Einschätzung.
Die Frage, ob es in Deutschland besonders kritische Bundesländer gebe, muss er bejahen: "Hessen und Sachsen haben z. B. definitiv ein Problem." Angesichts der aktuellen Entwicklungen stellt sich die Frage, ob die juristische Handhabe ausreichend ist: "Die rechtlichen Möglichkeiten sind gut entwickelt, es kommt darauf an, sie auszuschöpfen", so Botsch.
Querverbindungen mit Österreich
Wie real ist die Bedrohung hierzulande – und wie sieht es mit Querverbindungen aus? "Österreichische und deutsche Rechtsextreme sind seit jeher stark vernetzt, es kommt zu vielfältigem – auch personellem – Austausch. Die heimischen Strukturen sind stark genug, um nicht auf Hilfe aus dem Nachbarland angewiesen zu sein. Mitunter leisten umgekehrt österreichische Rechtsextreme 'Entwicklungshilfe' in der Bundesrepublik, etwa im Fall der 'Identitären', bilanziert Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) (siehe Interview).
Vieles spiele sich "in kleinen Zirkeln ohne feste Organisationsstrukturen" ab. Aber: "Schaut man sich an, dass es für eine terroristische Tat nur eine Person benötigt, die den Schalter umlegt, ist diese Bedrohung natürlich auch in Österreich gegeben".




