Als das Ende des Ersten Weltkrieges auch die Implosion der Habsburgermonarchie brachte, war das Ziehen neuer Grenzen im Zentrum Europas unabdingbar. Dass es den alten „Nationalitäten“ mit Ausnahme der Deutsch sprechenden Bevölkerung Cisleithaniens und der Ungarn gelang, sich auf die Seite der Sieger zu stellen, machte es ihnen einfach, territoriale Forderungen an die Verlierer zu erheben. Dabei berief man sich entweder auf das Bestehen historischer Grenzen oder aber auf das Selbstbestimmungsrecht, wie es der US-amerikanische Präsident Wilson in seinen 14 Punkten formuliert hatte.
Im Süden der ehemaligen Monarchie gab es zwei Siegermächte, deren Interessen durchaus auch kollidierten und denen jeweils Zusagen gemacht wurden, die einander widersprachen. Italien und der neue Staat der Serben, Kroaten und Slowenen konnten schwerlich ihre Interessen gegeneinander durchsetzen, wohl aber konnten sie versuchen, sich an Österreich, dem „Rest“, wie es der französische Ministerpräsident Clemenceau formulierte, schadlos zu halten. So kam es zur Grenzziehung in Tirol, eine Grenze, die Jahrzehnte die Emotionen hochgehen ließ, und so kam es auch zu den Ansprüchen der Südslawen, die Draugrenze in Kärnten zu fordern (und militärisch durchzusetzen).
Die Steiermark war ein Sonderfall: Mit den historischen Kronlandgrenzen konnte niemand argumentieren, eine Teilung des Landes stand außer Frage. Aber wo sollte die Grenze verlaufen? Wie sollte man mit Sprachinseln umgehen? Was bedeutete in der sprachlichen Gemengelage das viel beschworene Selbstbestimmungsrecht? Es ist unbestritten, dass das alte Kronland Steiermark zweisprachig war. Etwa ein Drittel der Bevölkerung sprach zu Hause Slowenisch, aber der Anpassungsdruck an die als überlegen empfundene deutsche Kultur und Sprache war enorm, besonders wenn man von zu Hause wegzog, um in der Hauptstadt Graz Arbeit zu finden. Tausende Menschen aus der Untersteiermark folgten dem Sog der Industrialisierung und Urbanisierung, aber nur knapp 1,2 Prozent der Grazer Bevölkerung gab 1880 an, Slowenisch als Muttersprache zu haben.
In der Untersteiermark selbst war das Bürgertum der Städte deutschsprachig, die Dienstboten und die Menschen im ländlichen Umfeld sprachen überwiegend Slowenisch. Um jede topografische Aufschrift, um jedes Theater, jede Zeitung und vor allem jede Schule wurde ein Kulturkampf geführt. Vereine waren Träger dieser Auseinandersetzung. Schulvereine, Turnvereine, Sängerbünde und auch karitative Organisationen von Frauen.
„Nation“ meint klarerweise mehr als „Sprachnation“, sonst gäbe es etwa wohl keine Schweiz. Vor allem aber ist auch Sprache wechselbar, man ist vielleicht gezwungen, in einer neuen Sprache zu kommunizieren, oder aber der Partner kommt aus einer anderen Sprachfamilie. Wohin gehören dann die Kinder? Sprachgrenzen sind daher fließend und Sprache ist nicht notwendigerweise gleichzusetzen mit nationaler Zugehörigkeit. Die „Grenze im Kopf“ wurde in der Untersteiermark also schon lange vor dem Ziehen der realen Grenze fixiert, als eine bewegliche Grenze, die es zu verteidigen, oder aber, wie eine Frontlinie, nach „vorne“ zu verschieben galt. Die Sprachgrenze war also als politische Grenze nicht zu ziehen, die Gemengelage der beiden Sprachen erlaubte keine Linienführung, die der realen Situation entsprechen konnte.
Im letzten Kriegsjahr war es deutlich geworden, dass die slowenischen Soldaten, die lange loyal in den Verbänden der Habsburgermonarchie gekämpft hatten, vermehrt ein bisher nicht existentes „Slowenien“ anstrebten, entweder innerhalb der Monarchie oder als Teil eines neuen „Jugoslawiens“. In jedem Fall zeichnete sich ab, dass eine neue Grenze quer durch den südlichen Teil der Steiermark gezogen werden musste. Es gab Bezirksgrenzen, Gemeindegrenzen, es gab die Mur, aber es fehlten Gebirgszüge. Die Mur war ja auch verbindend, sie lief durch Städte wie Radkersburg, man hatte Brücken gebaut, und auch die Eisenbahnlinie hatte sich nicht um Sprachgrenzen gekümmert. Wo immer man die Grenze zog, immer würden Grundbesitzer ihr Land auf beiden Seiten der Grenze finden.
In den südlichen Bezirken hatte bei Kriegsende der SHS-Staat die Kontrolle übernommen, aber die Position der Städte Marburg/Maribor, Pettau/Ptui und Cilli/Celje blieb ungeklärt. Als eine amerikanische Kommission unter der Leitung von Colonel Sherman Miles einen Lokalaugenschein durchführte, schuf der ehemalige Hauptmann der österreichischen Armee, Rudolf Maister, in Marburg/Maribor blutig neue Tatsachen. Ein Teil der deutschsprachigen Bevölkerung hatte sich mit österreichischen Fahnen vor dem Rathaus eingefunden, um die Amerikaner vom deutschsprachigen Charakter der Stadt zu überzeugen.
Maister ließ schießen, und 13 Tote sowie 60 Verwundete lagen auf den Straßen. Die Amerikaner fanden schließlich eine südslawisch beflaggte Stadt vor. Radkersburg war schon am 1. Dezember 1918 von SHS-Truppen besetzt worden, und auch die Gemeinden Glanz, Leutschach und Schlossberg wurden vom südslawischen Staat für sich beansprucht.
Die Friedensverhandlungen sprachen alle diese Gebiete anfangs dem SHS-Staat zu. Die im August 1919 endgültig gezogene Grenzlinie hielt sich aber an die Mur, teilte also die Stadt Radkersburg. Auch Leutschach und die Nachbargemeinden wurden Österreich zugesprochen. In mühevoller Kleinarbeit, Hof um Hof, wurde die Grenze überall dort gezogen, wo sie nicht durch den Fluss vorgegeben war. Manch dramatische, oft sogar traumatisierende Familiengeschichte kann von dieser Grenzziehung berichten.
In einer kleinen Ausstellung wird das Universalmuseum Joanneum diese Prozesse in einigen Wochen nachzuzeichnen versuchen. Und sie wird in zwei weiteren Teilen das Schicksal der Grenzregion bis zur Gegenwart nachzeichnen. Denn manche Wunde, die damals zufügt wurde, ist bis heute nur schlecht verheilt. Der Nationalsozialismus schob für einige Jahre die Grenze wieder nach Süden vor, ehe die Republik Österreich in den Grenzen von 1919 im Jahr 1945 wieder entstand.
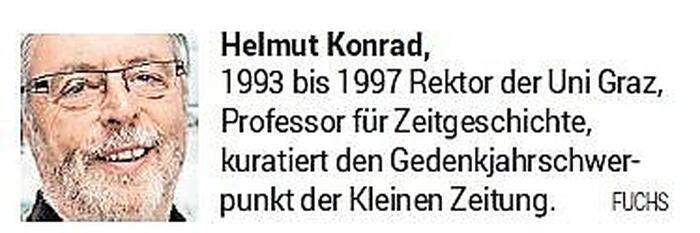
Helmut Konrad













