In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Wien zumindest zweimal im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Das galt für den Jahrhundertbeginn, als sich das kulturelle Wien in seiner ganzen multiethnischen Vielfalt als „Traum und Wirklichkeit“ entfaltete. Und das war zwei Jahrzehnte später, als das soziale und kulturelle Experiment des „Roten Wien“ als Modell für eine moderne Großstadt mit prägnant politischer Konnotation die Aufmerksamkeit auf sich zog.
Die beiden Geschichten zu Wien sind keine schroffen Gegensätze. Wohl war die kulturelle Hochblüte des Fin de Siècle auf das Zentrum der Stadt fixiert, das Rote Wien rückte hingegen die Peripherie ins Licht. Wohl waren es auf der einen Seite die bürgerlichen Wohlstandsfamilien, auf der anderen Seite die armen und ausgebeuteten Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber die Gestalter des Roten Wien waren meist Teil der intellektuellen Elite, und die Künstlerinnen und Künstler standen dem sozialen Experiment dominant wohlwollend gegenüber. Und beide Experimente waren zudem entscheidend vom jüdischen, meist eher schon fern seiner Religion sozialisierten Bildungsbürgertum getragen.
Wien war zu Beginn des 20. Jahrhunderts dreifach aufgefaltet.
Innerhalb des Rings wohnten der alte Adel und das neue, vermögende Großbürgertum, das sich in der Ringstraßenarchitektur in seinen Ansprüchen verwirklichte. Außerhalb des Rings dominierten Beamte und Kleinbürgerfamilien. Die äußeren Vorstädte, außerhalb des Gürtels, waren dominant proletarisch, meist nicht deutschsprachig, und hier herrschte das Elend des industriellen Klassenkampfes. Das liberale Wien, das zumindest bis 1894 so bezeichnet werden konnte, setzte Modernisierungsschritte, die auch das konservative, populistische und antisemitische Wien unter Karl Lueger konsequent weiterführte. Beide hatten aber keine Antworten auf das Elend der Vorstädte.
Nach Luegers Tod im Jahr 1910 war die Sozialdemokratie erkennbar die stärkste Kraft in der Stadt, was aber vorerst nur im Resultat der Parlamentswahlen von 1911 zum Ausdruck kam. Diese Sozialdemokraten waren aber selbst in der Stadt keine homogene Bewegung.
Da gab es erstens die Austromarxisten, die sich um die Theoriezeitschrift „Der Kampf“ gruppierten und die, international hoch angesehen, eine österreichische Spielart des Marxismus entwickelten, der in der Analyse der nationalen Frage die Wissenschaft weltweit beeinflusste.
Zweitens gab es die Gewerkschaften, national bereits gespalten, aber organisationsstark und vor allen finanziell das Rückgrat der Partei. Die dritte Gruppe bildeten die leicht lenkbaren Massen der Vorstädte, die dem Volkstribun Franz Schuhmeier folgten und die dessen Begräbnis 1913 zu einer Machtdemonstration mit einer halben Million Teilnehmern machten. Mit diesen überlappend gab es Anarchisten, Sozialrebellen und vieles mehr. Auch im Ersten Weltkrieg zeigten sich Widersprüche innerhalb der Sozialdemokratie. Während Karl Renner ein Staatsamt in der Lebensmittelversorgung übernahm, schritt die Linke zur Tat.
Am 21. Oktober 1916 erschoss Friedrich Adler, der hochbegabte Sohn des Parteigründers Victor Adler, den österreichischen Ministerpräsidenten Graf Stürgkh. Diese Gegensätze dauerten über das Kriegsende hinaus an.
Es gab den großen Jännerstreik, der sogar den Bolschewiki in Russland Hoffnung auf eine Weltrevolution machte, es gab aber auch den pragmatischen Kampf gegen Hunger und Krankheit, vorerst vor allem die Tuberkulose, dann bei Kriegsende die Spanische Grippe. Zeitgleich mit dieser schwappte eine völlig unkoordinierte Welle von Frontheimkehrern und Flüchtlingen in die Stadt, für die es weder Wohnraum noch Kleidung oder Nahrung gab. Das war der Nährboden der „österreichischen Revolution“.
Es ist das große Verdienst der Sozialdemokratie, dass es ihr gelang, das revolutionäre Potenzial dieser Situation so weit zu domestizieren, dass keine Räterepublik nach dem ungarischen Modell entstehen konnte, dass aber gleichzeitig das revolutionäre Drohpotenzial groß genug blieb, um dem Bürgertum massive Zugeständnisse, vor allem in der Sozialpolitik, abzuringen. In Wien wurde schon wenige Tage nach der Republikgründung eine provisorische Gemeindevertretung etabliert, die sich nach den kommunalen Wahlen vom 4. Mai 1919 endgültig nach den neuen Machtverhältnissen umgruppierte. Die Sozialdemokraten errangen 54 Prozent der Stimmen und 100 Mandate. Fast gleichzeitig mit dem Zerbrechen der Großen Koalition im Bund vereinbarten Wien und Niederösterreich die organisatorische Trennung, die im November 1920 in der Bundesverfassung festgelegt wurde. Realisiert wurde sie im Dezember 1921, und ab 1. Jänner 1922 war der Wiener Bürgermeister auch Landeshauptmann.
Die Rechtsstellung als Bundesland erlaubte die Steuerhoheit, ja sogar die eigene Steuerfindung. Das war notwendig, um soziale Maßnahmen setzen zu können. Und mit den nun in den nächsten Jahren umgesetzten Konzepten setzte sich Wien nicht nur von den anderen Bundesländern deutlich ab, sondern profilierte sich auch als Alternative zur Bundespolitik.

Der Gegensatz vom „Wasserkopf“ Wien, einer Stadt, die zu groß schien für die kleine Republik, und dem „flachen Land“ prägte von da an die innenpolitische Diskussion. Die politischen Experimente konnten auf einer sozial differenzierten Beschaffung der finanziellen Mittel aufbauen. Hugo Breitner, ehemals Direktor der Länderbank, führte direkte Steuern ein, mit ganz starker Progression, sodass tatsächlich die Reichen besteuert wurden. Gleichzeitig war er strikt gegen kommunale Verschuldung und zog Sparprogramme durch. Grundeigentum wurde hoch versteuert, und das galt besonders für Luxusgüter.
So gab es eine hohe Kraftfahrzeugsteuer, eine Klaviersteuer, eine Billardsteuer und Steuer auf Luxushunde oder Glühlampen. Von zentraler Bedeutung war aber die Wohnbausteuer, mit der wesentliche Teile des Wohnbauprogramms finanziert werden konnten, und die eine Mischung aus direkter Steuer und Luxussteuer war.
Innerhalb weniger Jahre erhielt Wien durch diesen kommunalen Wohnbau sein neues Gesicht. In einem knappen Jahrzehnt wurden 60.000 Wohnungen für etwa 250.000 Menschen errichtet, die ein Leben unter erträglichen Bedingungen ermöglichten. Das war das Kernstück, symbolisch und real, des sozialdemokratischen Wien. Der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt ist bis heute dessen Ikone. Weniger als 20 Prozent der Grundfläche sind verbaut, es gab und gibt dennoch Platz für 1.400 Wohnungen. Die Gesamtlänge beträgt einen Kilometer, es gibt Grünflächen, Bibliotheken, ein Krankenambulatorium, zwei Kindergärten, eine Zahnklinik, ein Postamt.
Der soziale Wohnbau reduzierte auch die Arbeitslosigkeit auf ein Viertel, zumal man wenig maschinenintensiv arbeitete. Für die politischen Gegner waren aber nicht Breitner und der Wohnbau die Feindbilder, sondern die Schulpolitik. Otto Glöckel sorgte schon in den ersten Monaten der Republik als Unterrichtsminister für Auseinandersetzungen. Als Präsident des Landesschulrats von Wien setzte er die freie Zurverfügungstellung von Unterrichtsmitteln durch, schuf Schulausspeisung, Schulbäder und Kleideraktionen. Er entwickelte das Konzept einer einheitlichen Mittelschule für alle Kinder bis 14 Jahre und orientierte sich an der Reformpädagogik. Klassenschülerhöchstzahlen wurden festgelegt, Arbeitsunterricht ersetzte die frontalen Einheiten. Das Erzielen von Durchlässigkeiten, die Förderung von Begabungen und die Vermeidung sozialer Diskriminierung waren Zielvorgaben. Ein Jahrhundert lang sollte die Diskussion um diese Sicht auf die Schule den österreichischen Bildungsdiskurs prägen.
Das Konzept des „Roten Wien“ war ein umfassendes. Es ging um lebensdeckende Betreuung vom Säuglingspaket bis zum Krematorium. Das beinhaltete medizinische Prophylaxe, Kindergärten, neue Schulformen, Wohnungen, Konsum, Freibäder, Sport und Erwachsenenbildung. Ein „neuer Mensch“ sollte durch die Politik zumindest mitgeformt werden, gesund, kulturell interessiert (David Josef Bach organisierte Arbeitersymphoniekonzerte), stolz auf die Stadt, ihr Erscheinungsbild und ihre Kultur. In Wien waren 400.000 Menschen Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei, darunter signifikant viele Frauen. Zwei Drittel der Wählerstimmen signalisierten breite Zustimmung zu dieser Form der Politik, und die Weltöffentlichkeit verfolgte das Experiment mit großer Aufmerksamkeit. Das „geistige Wien“, die Künstler und Künstlerinnen und die Intellektuellen bekundeten ihre Sympathie.
Dass sich Wien dadurch auch in der Alltagspraxis, vor allem aber in den kulturpolitischen Symbolhandlungen ganz stark vom übrigen Österreich entfernte und zu einer eigenen Welt wurde, machte es umso schwerer, eine österreichische Gesamtidentität zu entwickeln. Die große Weltwirtschaftskrise und das Aufkommen faschistischer Strömungen ließen das Experiment letztlich an der politischen Gewalt der Gegner scheitern. Der Justizpalastbrand 1927 war ein erstes Fanal, im Bürgerkrieg von 1934 starb dann aber nicht nur eine Partei, wie Josef Buttinger schrieb, sondern ein großer Gesellschaftsentwurf.
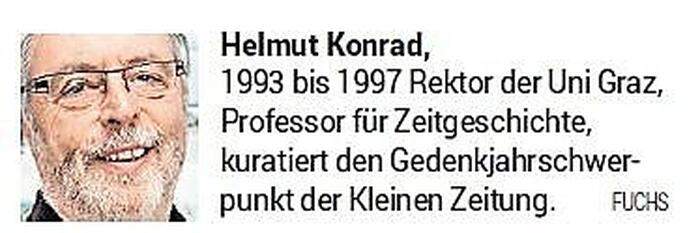
Helmut Konrad













