Als im 19. Jahrhundert das einstmals mächtige Osmanische Reich zu erodieren drohte, geschwächt durch die erfolgreichen Aufstände und Unabhängigkeitskriege der Serben und Griechen, durch die Unabhängigkeitsbestrebungen in Ägypten und durch die Interventionen der europäischen Großmächte, sprach man vom „kranken Mann am Bosporus“. Das Osmanische Reich galt als Staat, der den Modernisierungsprozess versäumt hatte, der nach innen die Legitimationsgrundlage verloren hatte und der von außen zum Spielball fremder Interessen geworden war. Der osmanische Vielvölkerstaat war praktisch längst zerfallen, als die armenische Tragödie ablief und als kurze Zeit später bedingt durch das Resultat des Ersten Weltkrieges die bis heute konfliktbeladenen neuen Trennlinien in der Region gezogen wurden. Vom Osmanischen Reich ging in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Weltpolitik und für die Großmächte keinerlei Bedrohung mehr aus, es lebte nur noch vom alten Glanz.
Ernst Hanisch, der angesehene Salzburger Historiker, habilitierte vor 40 Jahren mit einer großen Arbeit zur späten Habsburgermonarchie. Er untersuchte die Erwartungshaltungen der linken Revolutionäre von 1848, Karl Marx und Friedrich Engels, bezogen auf den multiethnischen Staat. Nicht zufällig nannte Hanisch sein Werk „Der kranke Mann an der Donau“, denn Marx und Engels sagten der Monarchie ein ähnliches Schicksal voraus, wie es das Osmanische Reich vor ihren Augen gerade durchlief. In den zwei Jahrzehnten nach 1848 wurde seitens der Revolutionäre das bevorstehende Ende der Monarchie mehrfach herbeigesehnt und ausgerufen.
Der Staat sollte aber noch ein weiteres halbes Jahrhundert überdauern und sich zumindest bis ins dritte Kriegsjahr des Ersten Weltkrieges als stabil erweisen. Selbstverständlich, „Kakanien“, wie es Robert Musil nennt, hatte seine manchmal aus der Zeit gefallenen Strukturen, seine überbordende Bürokratie und seine manchmal operettenhafte Gesellschaft. Und obwohl der Staat in mancher Hinsicht aus der Zeit gefallen schien, so hatte er doch seinen speziellen Kitt, der ihn erstaunlich lange funktionieren ließ. Aus der Zeit gefallen war die Habsburgermonarchie, da das 19. Jahrhundert in den sogenannten „Nationalstaaten“ die notwendige Grundlage für Fortschritt und Modernisierung sah. Nur eine einheitliche Staatssprache schien im Zeitalter der Normierung eine einheitliche Verwaltung und den unbehinderten Transport von Menschen und Waren zu gewährleisten. Die nunmehr populären Printmedien leisteten ihren Beitrag, diese Einheitlichkeit von Sprache (und diese Normierung der Weltbilder) voranzutreiben.
Die Donaumonarchie lag quer zu diesen Bestrebungen, aber im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts stellte der Staat „immer häufiger und immer nachhaltiger seine einzigartige Fähigkeit unter Beweis, aus der kulturellen Diversität seiner Völker produktive Kraft zu gewinnen“, wie Pieter Judson, der wohl beste Kenner jener Epoche, schreibt.
Es steht heute außer Frage, dass die kulturelle Hochblüte vor allem der Haupt- und Residenzstadt Wien nicht zuletzt der Vielschichtigkeit der Gemengelage zu verdanken ist, den unterschiedlichsten Quellen, aus denen sich die Musik, die Literatur, ja sogar die Küche speisen konnte. „Traum und Wirklichkeit“, die große Ausstellung, die das historische Museum der Stadt Wien schon 1985 zeigte, führte einem internationalen Publikum vor Augen, dass es der Ambivalenz und Vielschichtigkeit bedarf, um zu einer solchen kulturellen Hochblüte zu gelangen. Aber es geht keinesfalls nur um Wien um 1900, sondern es geht um die Frage, welche Kräfte es waren, die das große Reich entgegen dem damaligen Zeitgeist überleben ließen. Es sind zumindest fünf Komponenten, die den Bestand der Monarchie bis ins 20. Jahrhundert zu garantieren halfen und die den zentrifugalen Kräften, die es zur Genüge gab, Widerstand leisteten.
Der Kaiser: Vorweg ist der Monarch zu nennen, der Kaiser, der als junger Mann von 18 Jahren im Dezember 1848 auf den Thron gesetzt wurde, weil sein Onkel Ferdinand als zu schwach empfunden wurde (Ferdinand der Gütige wurde im Volksspott „Gütinand der Fertige“ genannt). Und der Vater Franz Josephs hatte verzichtet.
Der Kaiser machte jeden Schwenk mit: Regierte er zunächst absolutistisch, machte er nach der Niederlage von Königgrätz den radikalen Kurswechsel zur konstitutionellen Monarchie und zum Ausgleich mit Ungarn mit, der praktisch eine Realunion zweier Staaten schuf. Seine Familiengeschichte, seine Heirat, das tragische Schicksal des begabten Kronprinzen Rudolf, seine private Bescheidenheit machten ihn zu einer unangreifbaren Vaterfigur, die trotz manchmal problematischer Einflüsterer symbolisch überhöht wurde. Sein Geburtstag war ein Festtag. Streng konservativ verwahrte er sich gegen Umgestaltungen in der österreichischen Reichshälfte. Und in Überschätzung der militärischen Schlagkraft seines Heeres war er es, der mit seiner Kriegserklärung an Serbien den Ersten Weltkrieg auslöste.
Die Bürokratie: Die zweite bewahrende Kraft im Staat war die Bürokratie. Symbolisiert durch die Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes bis hin zur lokalen Architektur von Schulen, Bahnhöfen, Kasernen, Gerichten und Verwaltungsgebäuden, hatte sich in der Ausweitung der Verwaltungsaufgaben ein Heer von loyalen Staatsbeamten ausgebildet, bis heute symbolisiert im Bezirkshauptmann Franz Freiherr von Trotta in Joseph Roths „Radetzkymarsch“. Die vielfachen Verdoppelungen der Aufgaben durch die unterschiedlichen Verwaltungsebenen des Staates von der Gemeinde über den Bezirk bis hin zum Kronland und dem Gesamtstaat erzeugten enorme Kosten und forderten daher auch hohe Steuern. Und sie machten den Mechanismus für den einzelnen Bürger oftmals sehr schwer bis gar nicht durchschaubar. Franz Kafkas literarische Helden scheitern am Versuch, in diesem Dickicht eine höhere Ordnung zu erkennen. Aber der Staat leistete sich nicht nur teure „Parallelaktionen“, er funktionierte tatsächlich auch wegen seines loyalen Beamtenheeres einigermaßen bis hin zum Ersten Weltkrieg.

Das Heer: Seit 1868 war der Militärdienst in der Habsburgermonarchie so geregelt, dass er alle jungen Männer im Alter von 18 Jahren erfasste und drei Jahre dauerte. Hatte man eine Zulassung zum Universitätsstudium, konnte man sich zu einer einjährigen Ausbildung zum Reserveoffizier verpflichten, ein Weg, den auch viele jüdische Männer einschlugen, um später eine Laufbahn als Militärarzt antreten zu können. Die Kommandosprache der österreichischen Armee war Deutsch, die der ungarischen Honved war Ungarisch. Jeder österreichische Rekrut musste bis zu achtzig Kommandos auf Deutsch verstehen lernen, hatte aber das Recht auf Ausbildung in seiner Landessprache. Der Militärdienst war nicht (nur) unbeliebt, man bekam drei Jahre regelmäßigen Sold und wurde zumindest funktional mehrsprachig. Man kam herum und lernte andere Teile der Monarchie kennen. Und vor allem wurde man in der Loyalität zum Reich und zu seinem Herrscher geschult. So erzeugte man über die allgemeine Wehrpflicht ein übernationales Gefühl für den Gesamtstaat, ein Gefühl, das auch beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges abrufbar war.
Die Sozialdemokratie. Das Entstehen der Massenparteien mit ihrer Propaganda hatte weitgehend den Effekt, die zentrifugalen Kräfte der Monarchie zu befördern, da mit Emotionen gespielt und an nationale Gefühle appelliert wurde. Die Sozialdemokratie und zumindest anfangs auch die Gewerkschaften verstanden sich hingegen als übernational. Am Parteitag in Neudörfl, dem ersten Gründungsversuch der Sozialdemokratie, wurde das Protokoll in Deutsch und Tschechisch verfasst, in der Diskussion konnten beide Sprachen gleichberechtigt verwendet werden.
Man verstand sich als Bewegung, die keine nationalen oder sprachlichen Trennlinien anerkennen wollte, denn „der Kampf gegen die Ausbeutung muss international sein wie die Ausbeutung selbst“. Mehr noch: Nach der Jahrhundertwende waren es Otto Bauer und Karl Renner, die Bücher zur nationalen Frage verfassten, Bauer theoretisch, Renner mit dem Versuch, das sogenannte „Nationalitätenproblem“ praktisch zu lösen und den Bestand der Monarchie zu sichern. Nationale Rechte sollten nicht an ein Territorium, sondern an die Personen direkt gebunden werden, wie das Ausüben einer Religion. Damit wäre die Sprengkraft der nationalen Frage überwunden, jeder Mensch hätte dann das Recht, überall seine Sprache zu verwenden.
Die katholische Kirche. Das Haus Habsburg und die von ihm regierten Länder verstanden sich weitgehend als katholisch, obwohl seit Joseph II. das Ende der Gegenreformation eingeläutet worden war. Das Toleranzpatent von 1781 ermöglichte es den protestantischen und orthodoxen Kirchen, in Religionsfreiheit ihre Gottesdienste abzuhalten. Ein Jahr später wurde auch den Juden die Freiheit der Religionsausübung zugestanden. 1912 erhielt auch der Islam die Anerkennung als Religionsgemeinschaft und als Körperschaft öffentlichen Rechts.
Dennoch blieb die Dominanz des Katholizismus deutlich sichtbar und sie wurde auch durch das Herrscherhaus symbolisiert. Im gesamten Land war es vor allem die Architektur der Kirchen, die zumindest seit der Barockzeit die Stadt- und Dorfbilder prägte und die den jeweiligen Mittelpunkt der Gemeinschaft symbolisierten. Thron und Altar waren, trotz der europaweit einzigartigen Toleranz gegenüber den anderen Religionen, in enger Verknüpfung zu sehen.

Dies stärkte die Verbindungen der Landesteile emotional und optisch. Man erkannte an den Kirchen, dass man in Österreich war. Vor vier Jahren nannte eine Ausstellung im jüdischen Museum von Hohenems die jüdischen Bewohner der Habsburgermonarchie „die ersten Europäer“. Tatsächlich bot die Monarchie eine bis dahin nicht bekannte Möglichkeit, transnationale Netzwerke zu knüpfen, auf Mobilität zu setzen und Diskriminierungen zu entkommen. Bildung und Künste standen offen, der Wissenschaftsbetrieb setzte fast ausschließlich auf Leistung, und selbst beim Militär standen über die militärärztliche Laufbahn die Offiziersgrade offen. Das sich rasch entwickelnde jüdische Bürgertum war die zentrale Trägerschicht nicht nur des ökonomischen Aufschwungs, sondern vor allem auch der künstlerischen Entfaltung. Das Judentum verehrte den Kaiser als Schutzpatron, und wenn man über alte jüdische Friedhöfe, etwa in Czernowitz, geht, kann man deutlich sehen, wie sehr sich die deutsche Sprache durchsetzen konnte und wie stark man den Traum eines religiös toleranten Lebens in der Habsburgermonarchie verwirklicht sah. Zwar waren die rund zwei Millionen Jüdinnen und Juden mit dem Aufkommen neuer Formen des Antisemitismus konfrontiert, der Kaiser galt aber als der Garant dafür, dass ein freies und unbehindertes Leben in der Monarchie möglich schien. Das „goldene Zeitalter“ wurde durch das Resultat des Ersten Weltkriegs abrupt beendet.
Es steht aber auch außer Frage, dass der Staat nicht den Vorstellungen aller, die in ihm lebten, entsprechen konnte. Zu sehr wurde in den letzten Jahrzehnten der Monarchie klar, dass es Benachteiligungen für jene Menschen gab, die nicht zu den dominanten Nationalitäten zählten. Die Tschechen und auch die Südslawen forderten Rechte, wie sie die Ungarn erhalten hatten, der Trialismus wurde als Alternative zum Dualismus ins Spiel gebracht. Mancher Mensch im Trentino träumte von der Einheit Italiens, und mancher Angehörige der deutschsprachigen Gruppe hatte den Ausschluss Österreichs aus dem deutschen Einigungsprozess nicht verwunden.
An den sogenannten Sprachgrenzen wurde um jede Schule gestritten und spätestens die Badeni-Krise von 1897, als der Regierungschef eine Sprachenverordnung für Böhmen und Mähren erließ, offenbarte die Unregierbarkeit eines Landes, das in nationale Parteien aufgesplittert war. Oft konnte nur mit Notverordnungen und Sistierungen des Parlaments regiert werden. Die demokratischen Errungenschaften wirkten sich kontraproduktiv auf die Einheit des Landes aus. Dennoch: Heute, beim Versuch von übernationalen Zusammenschlüssen in Europa, blickt man mit anderen Augen auf die Geschichte des Vielvölkerstaates. Vieles hat damals nicht funktioniert und manch dezentrale Tendenz war mit demokratischen Mitteln nicht einzufangen. Aber einiges hat das Zeug dazu, dass man heute noch genauer hinschaut: Dazu zählen die übernationalen Symbole, die religiöse Toleranz und die Korrektheit der bürokratischen Abläufe.
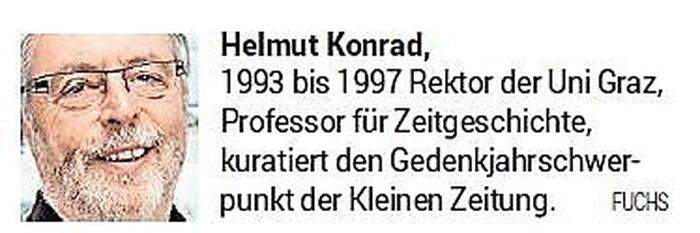
Helmut Konrad













