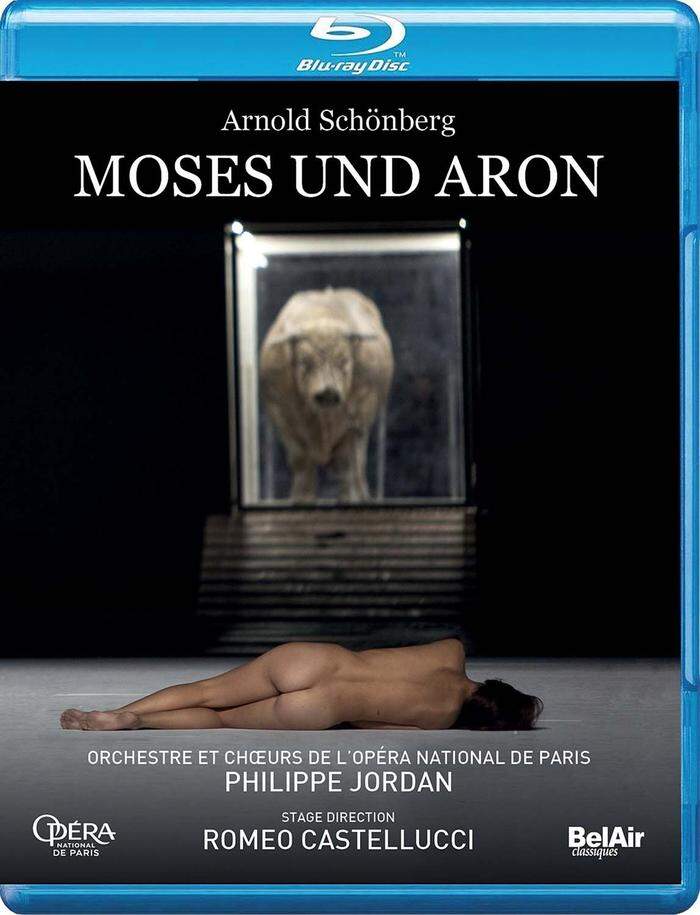„Die Bedeutung von Musik sind die Gefühle, die sich einstellen, wenn man sie hört.“ So Leonard Bernsteins Diktum, das der amerikanische Dirigent, Komponist und Pianist für die jugendlichen Zuhörer seiner „Young People’s Concerts“ artikuliert hat. Ein intuitiver, sinnlicher, auf das individuelle Empfinden abzielender Musikbegriff hat viel für sich. Arnold Schönbergs Zwölftonmusik ist sozusagen ein Gegenmodell zu diesem Konzept. Es war das Resultat einer rastlosen, jahrzehntelangen Suche. Im Wiener Fin-de-siècle führte Schönberg erst die Spätromantik an ihre Grenzen, er erschuf prachtvolle, in allen Farben schillernde Klangwelten, Zauberklänge, in die sich immer wieder Dissonanzen einnisten. Im Lauf der Jahre kippt seine Ablehnung musikalischer Formen in einen atonalen Expressionismus, eine Nervenmusik, die seine Zuhörer verstörte, weil sie das nicht nur das Ende der bekannten, romantischen, tonalen Musik einläuten wollte, sondern weil sie tatsächlich in einer Endzeit entstanden ist.
In einem der Hauptwerke Schönbergs, dem 2. Streichquartett von 1908, zitiert Schönberg ausgerechnet im Scherzo das Volkslied „O du lieber Augustin“: „Alles ist hin“. Ein Spiegel nicht nur der Zeitläufe und einer Entfremdung von der musikalischen Tradition, sondern auch Ausdruck einer tiefen persönlichen Krise, in die ihn die Affäre seiner Frau mit dem Maler Richard Gerstl geworfen hatte.
Dass er die Vergangenheit beweint, passt zu dem 1874 geborenen Sohn eines Juden aus Bratislava, denn in gewisser Hinsicht war Schönberg tief konservativ. Seine Revolution fußte auf einer genauen Kenntnis der alten Meister. Dabei war Schönberg selbst Autodidakt, hat nur ein paar Stunden Kompositionsunterricht bei Alexander Zemlinsky genossen. Zuerst heißen seine tief verehrten privaten Götter Richard Strauss und Gustav Mahler, doch bald sammelt er selbst Jünger um sich. Der jüngere Kollege Alban Berg wird sogar eine Art Hausdiener, des schneidend scharfen, apodiktischen Schönberg.
Schönbergs Leben blieb über Jahrzehnte ein Kampf: Der Kampf ums private Glück, der Kampf um Anerkennung, der Kampf gegen das „verständnislose“ Publikum. Entlang dieser Kämpfer gibt es die erstaunlichste Entwicklung, die man sich bei einem Künstler vorstellen kann. Von der Opulenz spätromantischer Anfänge geht bei ihm der Weg über die Expression in die Struktur. Ausgehend von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms, also den großen „Intellektuellen“ der Musikgeschichte bringt er die Tradition nicht nur zu einem Ende.
Er setzt einen Neuanfang. Mit seiner „Zwölftonmusik“ ist er bereit, ein neues Kapitel zu schreiben, in dem eine Musik schafft, die sozusagen auch der Gipfel der europäischen Kunstmusik, der absoluten Musik, ist. Ganz im Gegensatz zu Bernsteins eingangs erwähntem Diktum, schafft Schönberg Musik, die nur auf sich selbst bezogen ist. Das höchste Prinzip darin ist der musikalische Zusammenhang. Den Gehalt der Zwölftonmusik kann man schwer, bzw. überhaupt nicht, nur mit Gefühlen fassen. Es ist eine Herausforderung ans Publikum, sich mit der Konstruktion auseinanderzusetzen. Eine Absage an den „Komfort“ und den „Trost“ des Musikgenusses, eine Absage an Tausende Jahre Musikgeschichte und zugleich die höchste sublime Vollendung der Idee „Musik“.
Geneigte Laien, die über die Großartigkeit von Schönbergs Romantik, über die nervenzerfetzende Intensität seiner atonalen Phase zu diesem späten Schönberg vordringen, brauchen schon ein wenig Anleitung. Die üblichen Einführungen vor Konzerten sind fast nirgends so sinnvoll wie hier.
Schönberg selbst musste 1933 vor den Nazis fliehen. Der hellwache politische Geist und Lutheraner konvertierte daraufhin zum Judentum. Er ging in die USA, verlor das „ö“ und erhielt dafür ein „oe“. Aber es war eine „Vertreibung ins Paradies“ wie der am Witz und Schärfe eines Karl Kraus geschulte Schoenberg anlässlich seines Lebens in Kalifornien hervorhob. Er galt als Genie, spielte und war Salonlöwe, der mit Thomas Mann diskutierte und sich zerstritt. Er beschäftigte sich mit hebräischer Tradition, schuf erneut große Zwölftonwerke, liebäugelte mit dem Tonalen und Populären und wälzte sogar Pläne für Filmmusik. Am 13. Juli 1953, einem Freitag, starb der abergläubische Schoenberg in Los Angeles. Auf seinem Ehrengrab in Wien heißt er wieder Schönberg.