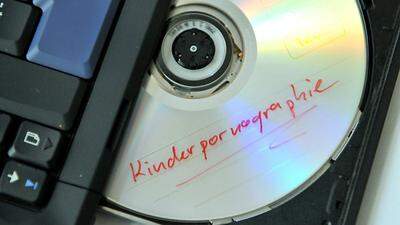An einem Gehirntest, der Pädophile erkennen soll, arbeitet derzeit in Forscherteam in der Schweiz. Bereits 43 Männer haben in Basel an dem Experiment teilgenommen: 20 verurteilte Straftäter, die Kinderpornografie konsumiert oder Kinder missbraucht hatten, sowie 23 Normalbürger. Sie alle ließen sich an Kopf und Fingern verkabeln und lösten Testaufgaben. Dabei wurden sie beispielsweise durch Kinderfotos abgelenkt, worauf erfasst wurde, wie stark die Ablenkung ausfiel. Die Apparate maßen, was die Probanden stimulierte.
Justiz fördert das Projekt finanziell
Die "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" hatten am Sonntag erstmals über die Experimente berichtet. Sie werden von Forschern der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel durchgeführt. Das Projekt wird vom Bundesamt für Justiz finanziell unterstützt. Parallel zum Basler Projekt bereiten auch Forscher der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich solche Tests vor.
Die Motivation für ihre Experimente sei ein Unbehagen über die heutigen Methoden, mit denen die Gefährlichkeit von Tätern eingeschätzt wird, sagten Forscher beider Projekte. "Es ist schwierig, pädophile Neigungen zu erfragen oder zu messen, wenn der Proband nicht bereit ist, darüber Auskunft zu geben", erklärte Andreas Mokros, der das Projekt in Zürich leitet.
Marc Graf, Direktor der Forensischen psychiatrischen Klinik in Basel und Leiter des dortigen Forschungsprojekts, weist auf dasselbe Problem hin: Wenn ein intelligenter Mensch während eines Therapieverlaufs versichere, er habe keine Kinderfantasien mehr, wisse man nicht, ob das stimmt. Mit dem Test, der jetzt entwickelt werde, hoffe man, die Objektivität eines Befundes wesentlich verbessern zu können, sagte Graf. Verlaufen die Versuche weiterhin erfolgreich, wäre der Einsatz dieses Detektors im Strafverfahren oder im Strafvollzug denkbar, glauben die Forscher.
Die Frage nach dem Motiv
Für gewisse Inhaftierte könnte der Test auch eine Chance sein, sagten die Projektleiter. Sie sprechen wegen Kindesmissbrauch verurteilte Täter an, die an sich keine pädophilen Neigungen haben. Diese könnten mit einem solchen Test zeigen, dass sie nicht pädophil sind. Studien aus Nordamerika zeigten, dass vermutlich fast 60 Prozent aller Missbrauchstäter keine pädophilen Neigungen hätten, sagte Mokros. "Diese Personen haben Kinder also aus anderen Gründen sexuell missbraucht, etwa weil sie Macht ausüben wollten, oder weil sie in Inzestfällen die Rolle der Ehefrau auf die Tochter übertragen."
Wenn der Grund für einen Missbrauch jedoch pädophile Neigungen seien, sei das Rückfallrisiko besonders hoch, erklärte Mokros. "Es scheint deshalb bei Ersttätern sinnvoll herauszufinden, ob sie eine pädophile Präferenz haben oder nicht." Dies könne helfen, die Rückfallgefahr abzuschätzen.
Grundsätzliche Bedenken gegen den Test
Mokros und Graf sind sich der Brisanz ihres Unterfangens bewusst. Die Experimente wecken Schreckensvisionen von flächendeckenden Gehirntests ohne Anfangsverdacht, von der systematischen Vermessung des menschlichen Gehirns nach allfälligen kriminellen Neigungen. Von der "SonntagsZeitung" und "Le Matin Dimanche" befragte Richter äußerten auch grundsätzliche Bedenken.
"Es darf keine verdachtsunabhängige Untersuchung geben", sagte der Forensiker Mokros und mahnt generell zur Zurückhaltung. Die Tests müssten möglichst lange im Forschungsstadium bleiben, bis ihre Zuverlässigkeit hinreichend bestätigt sei. Und selbst dann dürften sie nur als ein zusätzliches Element in einer ganzen Reihe von Untersuchungen eingesetzt werden. "Der Test soll die herkömmliche Analyse nicht ersetzen, sondern ergänzen", sagte Mokros.
"Wir müssen mit dieser technischen Entwicklung sehr sorgfältig umgehen. Solche Tests sind nicht nur ethisch-moralisch, sondern auch rechtlich heikel", meinte Graf. Es müsse eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden, ob solche Tests in der einen oder anderen Form anwendbar seien. "Wir sind primär der Wissenschaft verpflichtet. Wir forschen, weil wir diese Zusammenhänge verstehen wollen."